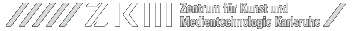Medium für die Medienkunst, Medium für den Bürger
Ein Rückblick auf 20 Jahre »mediagramm«
Als das ZKM im Sommer 1989 als Stiftung des öffentlichen Rechts gegründet wurde,
hätte man es zunächst zu Recht ein Zentrum ohne Zentrum nennen können. Eine
bauliche Institutionalisierung stand noch aus und sollte erst 1997 mit dem
Einzug in den Hallenbau A des ehemaligen IWKA-Geländes ihren Abschluss finden.
Schnell formierte sich ein Medium, welches dieses fehlende Zentrum der
Anfangsjahre zu überbrücken wusste. Das »mediagramm« – gelegentlich auch
»mediaprogramm« genannt – die im September 1990 erstmals herausgegebene
Hauszeitung des ZKM, wollte, dem Selbstverständnis der Macher entsprechend, von
Anfang an die Ideen und Visionen des ZKM an die Bürger herantragen und damit die
Prozesse einer sich erst formierenden und immer weiter ausdifferenzierenden
Institution – vor allem auch dem Karlsruher Publikum – transparent machen. Neben
den vielen kritischen, essayistischen und kreativ-experimentellen Beiträgen aus
den Bereichen Gegenwartskunst, Philosophie und Musik, Berichten über Symposien
sowie einer Auseinandersetzung mit den Neuen Medien, war das »mediagramm«
rückblickend sicher mehr als eine reine »Informationsbörse« (Nr.1, S.1): als
damals einzige dauerhafte Schnittstelle zwischen ZKM und Öffentlichkeit war es
das Sprachrohr und Gesicht des ZKM. Bis heute lässt sich daran die Entwicklung
von einer Vision hin zu deren Verwirklichung einer international etablierten,
weltweit einzigartigen Kulturinstitution nachvollziehen.
Nach einem Beschluss vom Mai 1990 sollte sich die Zeitung, die aktuell unter dem Titel »mediagramm« ihr zwanzigjähriges Bestehen feiert, ursprünglich »Kunst und Medien« nennen. Bis zum Erscheinen der ersten Ausgabe im September 1990 sollten noch eine ganze Reihe von Namen erdacht und wieder verworfen werden: kurz vor Redaktionsschluss ließ man auch den Namen »MultiMedia«, den sich ein Pforzheimer HiFi-Discount erst kurz zuvor gesichert hatte, fallen. Plötzlich waren alle Mitarbeiter und Freunde des ZKM aufgerufen, schnellstmöglich einen neuen Namen für die Hauszeitung zu erfinden. In einem Mehrheitsbeschluss setzte sich daraufhin der Name »mediagramm« durch: Der Wortstamm »Media« verweist auf Nachrichten, auf die multimediale Position der Künste sowie auf ein grundsätzlich gattungsübergreifendes Verständnis der Kunst, »gramm« (vom griechischen γράμμα) bedeutet das Geschriebene.
Ein Archäologe in der Medienkunst
Verantwortlich für die Konzeptionierung und Realisierung der Hauszeitung war Ludger Hünnekens, der heute das Museum Frieder Burda in Baden-Baden leitet. In der jüngst erschienen Publikation »Re-Visionen der Moderne. Begegnungen mit Heinrich Klotz« erzählt Hünnekens, wie er, als klassischer Archäologe und damals Mitarbeiter der Antikensammlung des Badischen Landesmuseums, sich gegen den konventionellen Weg und für das Abenteuer ZKM entschied, als Heinrich Klotz ihn bat, mit ins »Boot des ZKM« zu kommen. Seine damalige Tätigkeit am ZKM beschreibt Hünnekens als »Allround«-Funktion, denn ein klar abzugrenzendes Aufgabenprofil gab es noch nicht: »Auf zu neuen Ufern also, dem ZKM aus seiner Aporie der Vorlaufzeit heraushelfen, ihm ein Programm, ein Gesicht, ein Forum und eine Zukunft geben.« (Rottenburg/ Arnecke 2010, S. 95) In diesem Sinne hob er das »mediagramm« aus der Taufe, konzeptionierte und koordinierte das Pilotprojekt. »Wir hatten nicht viel Vorlauf. Die Hauszeitung diente hauptsächlich der Information der Leute. Wir wollten nicht im stillen Kämmerlein arbeiten, sondern sofort damit raus an die Öffentlichkeit gehen.«, erzählt Hünnekens. »Wir wollten die Bürger ins Boot holen und von Anfang an den Charakter des Elitären relativieren.« (Mündliche Mitteilung, September 2010)
Handarbeit und Geduld
In enger Zusammenarbeit mit der Karlsruher Werbeagentur Knauer erschien Ende September 1990 »mediagramm« Nr. 1 mit einer Auflage von 6.000 Exemplaren im aufwendigen Bogen-Offsetdruck. Aus der gegenwärtigen Perspektive digitalisierter Arbeitsprozesse betrachtet, muss die Leistung, in derart kurzer Zeit ein Zeitungsprojekt auf die Beine zu stellen, umso mehr honoriert werden. Fotografien wurden auf dem Postweg von Los Angeles nach Karlsruhe geschickt, Briefe und Faxe mit Korrekturen gingen mehrmals hin und her, was den Arbeitsprozess, verglichen mit heute, ungemein verlangsamte. Marianne Bruder und Rita Weichsel, die noch immer für das ZKM tätig sind, erinnern sich noch gut an den organisatorischen Aufwand der Anfangsjahre. »Viele Texte von Gastautoren kamen handschriftlich und mussten erst noch eingetippt werden«, berichtet Marianne Bruder (Mündliche Mitteilung, Juli 2010). »Und hinterher mussten alle Fotos und Disketten, inklusive der Belegexemplare, wieder zurück gesandt werden«, ergänzt Rita Weichsel (Mündliche Mitteilung, Juli 2010).
In den Folgejahren gab es immer wieder Impulse, das »mediagramm« umzugestalten und klarer zu positionieren. Viola Gaiser, damals Volontärin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und heutige Leiterin der ZKM | Veranstaltungsabteilung erinnert sich, dass die Ausrichtung des »mediagramm« immer schon ein Thema gewesen sei, inwiefern man sich eher an ein akademisches oder an ein breites kunstinteressiertes Publikum richtet (Mündliche Mitteilung, Juli 2010). Vielleicht war und ist es aber auch genau die Schnittmenge der unterschiedlichen Beiträge, die die Zeitung ausmachen und die vielleicht gerade in ihrer uneindeutigen Ausrichtung immer ihren Reiz hatte. »Denn so wenig wie sich unsere Institution verkrusten will, so offen und transparent soll auch ihr Sprachrohr bleiben.«, so hatte Klotz es in der ersten Ausgabe formuliert.
Interviews aus der Hexenküche
So war das »mediagramm« stets eine Mischung neuer Mitteilungen aus dem ZKM und
seit 1992 auch der Hochschule für Gestaltung (HfG), kritischer Berichte zu
aktuellen Ausstellungen, Messen und Kongressen sowie fachspezifischer
theoretischer Essays. Gastautoren kamen ebenso zu Wort wie ZKM- und
HfG-Mitarbeiter, wodurch thematisch ein ständiger Austausch von innen und außen
gewährleistet war. Eine Vielzahl der Reihen und Rubriken, etwa »Die Leiter der
Institute werden vorgestellt« oder »Neue Vermittler« sollten den Lesern die
Orientierung im Blatt erleichtern. Auf diese Weise versammelten sich über die
Jahre die vielfältigsten Beiträge und journalistischen Formate, die Teil der
kulturellen Debatte wurden. Vor allem den Festivals »MultiMediale«, damals
Aushängeschild des ZKM, wurde mit mehreren Sonderausgaben Rechnung getragen.
Susanne Schuck-Zöller, die bis 1997 Leiterin der ZKM | Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit war und sich heute der Wissenschaftskommunikation widmet,
erinnert sich gerne an die Interviews mit Künstlern zurück: »Mit Marie-Jo
Lafontaine beispielsweise habe ich ein sehr bewegendes Gespräch (Nr. 21, S. 14f)
geführt, indem sie viel von sich und ihrer Kunst preisgegeben hat. Damals hatten
wir am ZKM ihre Installation »Jeder Engel ist schrecklich« ausgestellt.«
(Schriftliche Mitteilung, Juli 2010). Und Ludger Hünnekens stellt heraus:
»Spannend fand ich natürlich immer, über die Produktionen aus der eigenen
Hexenküche zu schreiben, die ja auch international Beachtung fanden, zum
Beispiel über den Medienkunstpreis zu berichten und die Preisträger
vorzustellen. Besonders reizvoll waren auch die Gespräche, etwa mit Vilém
Flusser und Peter Weibel.« (Mündliche Mitteilung, September 2010).
Auffällig in der Zeitung der Anfangsjahre ist vor allem die Nähe zu den Bürgern
und die Suche nach einem Gegenüber. Das Klotzsche Credo der ersten Ausgabe, ein
»Medium für den Bürger« zu sein, schreibt sich in vielen weiteren Aufrufen zu
Leserbriefen und Gastbeiträgen fort: »Beziehen Sie Position, liefern Sie uns
Beiträge!« (Nr. 3). Viel Rücklauf sei zu diesen Aufrufen zwar nie gekommen, so
die ehemaligen Redaktionsmitglieder, doch hin und wieder gab es ein Feedback,
etwa im Frühjahr 1993 von Herrn Schütz aus Karlsruhe: »Ihre letzte Ausgabe finde
ich voll gelungen (die letzten Ausgaben waren eher ›zu dünn‹). Ein
Veranstaltungskalender des ZKM und der HfG im »mediagramm« zum Ausschneiden und
zum Aufhängen für die nächsten drei Monate wäre wohl dienlich.«
Von der Zeitung zum Programmheft
Bereits eineinhalb Jahre nach Erscheinen der ersten Ausgabe gab es den Impuls
eines neuen grafischen Konzepts. Ab Ausgabe Nr. 6 lag die Gestaltung des
Zeitungsformats beim Grafikbüro Frank+Ranger in Stuttgart, die gemeinsam mit dem
Team des ZKM nach unkonventionellen grafischen Lösungen für ein insgesamt
unkonventionelles Konzept suchten. »Wir konnten den kleinen
Marketing-Spezialisten im eigenen Kopf hier zugunsten eines anspruchsvollen
grafischen Konzeptes außen vor lassen, besonders was die Titelseiten anlangte.«,
erzählt Susanne Schuck-Zöller. Ende 1998 verabschiedete man sich gänzlich vom
Zeitungsformat und beschritt mit einem bunten, hochformatigen DIN A 4-Heft neue
Wege. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: War das »mediagramm« bis zur
Eröffnung des ZKM Ende 1997 eine Hauszeitung ohne Haus, so war es nun im
Hallenbau A sozusagen heimgekehrt. Mit der Voraussetzung neuer Räumlichkeiten,
die dauerhaft bespielt werden konnten, stiegen auch das Programmangebot, die
Ausstellungen und die Zahl der Veranstaltungen kontinuierlich an. Darin liegt
der allmähliche Übergang von einer Zeitung hin zu einem Programmheft begründet.
Die Institution ZKM hatte nun ein Gesicht, wovon sich jeder selbst überzeugen
konnte und was die reine Berichterstattung der Anfangsjahre obsolet werden ließ
– dafür aber nach einer Orientierungshilfe für die Besucher verlangte. Mit Peter
Weibel an der Spitze des ZKM wurde grafisch bei der »mediagramm«-Produktion
experimentiert. Zwischen 1999 und 2002 produzierte man aufwendig gestaltete
siebenseitige DIN A4-Leporelli, die 2003 – aufgrund des immer umfangreicher
werdenden Programms, welches nicht mehr unterzubringen war – durch eine
geheftete Version abgelöst wurden. Ab dem Jahr 2004 entschied man sich dann für
ein kleineres DIN lang Format, das in jede Hosentasche passte. Bis heute hat man
dieses beibehalten, einzig die Seitenzahlen sind von rund 30 auf bis zu 60
Seiten kontinuierlich gestiegen. Der Anstieg der Auflagenzahl von ehemals 6 000
auf aktuell 24 000 Exemplare zeigt, wie das ZKM in seinem Programm wie auch in
seiner Anerkennung gewachsen ist. Das »mediagramm« ist dabei immer eine
Orientierungshilfe – nicht nur für die Karlsruher Besucher – gewesen.
Denise Rothdiener