|
ALİ AYHAN
Sortiment Manager, After-Sales Service, baureihenübergreifende Betreuung der Nachserie im Bereich Rohbau-Body Parts, Optimierung des Sortiments Rohbau-teile, Strategieentwicklung zur Teileanlage bzw. -reduktion.
Ali Ayhan hat, ausgehend von einem Realschulabschluss, dem ein Jahr lang das kaufmännische Berufskolleg folgte, eine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbauer absolviert.
Er war einige Jahre in der Produktion in einem Automobilunternehmen tätig und entschloss sich dann für eine Weiterbildung zum Industriemeister-Metall, die er nach 3 1⁄2 Jahren erfolgreich beendete. Anschließend wurde er von seinem Arbeitgeber in Bereichen beschäftigt, die der Produktion nachgelagert sind („After-Sales Technik Rohbau“) und bei denen es insbesondere um technische Aufgaben im Rahmen der Kunden- und Lieferantenbetreuung geht, so technische Serviceleistungen, insbesondere Optimierung des Bestandes in Absprache mit den Lieferanten.
Herr Ayhan beherrscht neben der deutschen Sprache auch seine Muttersprache sowie Englisch in Wort und Schrift.
Industriemeister - Metall
Der Industriemeister - Metall ist eine Führungskraft auf der mittleren Ebene in der Metallindustrie, so beispielsweise im Anlagen-, Fahrzeug- und Maschinenbau. Er wirkt als Bindeglied zwischen der produktionstechnischen und kaufmännischen Seite.
Als Industriemeister Metall arbeitet man zum einen direkt in den Produktionshallen der Betriebe, aber auch im Büro, um Planungs- und Organisationsaufgaben zu erfüllen. Der Industriemeister-Metall ist in Großbetrieben vielfach für einen bestimmten Zuständigkeitsbereich weitgehend verantwortlich und muss so ein breites und vertieftes Fachwissen besitzen, damit er Arbeitsplätze bzw. Anlagen einrichten, den Arbeitsablauf planen und Mitarbeiter einteilen und anleiten kann. Schwerpunkte seiner Ausbildung sind Technik (Betriebstechnik, Fertigungstechnik, Montagetechnik), Organisation (Rechnungswesen, Planung, Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz) und Personal (Personalführung, Personalentwicklung).
„Meister-BAföG“
Der Entschluss, eine Weiterbildung zu absolvieren, ist immer mit der Frage verbunden, wie man das finanzieren kann, da die Kurse Kosten verursachen und natürlich auch der Lebensunterhalt gesichert werden muss. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, neben einer eigenen Finanzierung, eine Unterstützung durch den Arbeitgeber oder eine öffentliche Förderung zu erlangen. Bezüglich der öffentlichen Förderung der Weiterbildung gibt es eine interessante Möglichkeit für Fachkräfte, die unter dem Namen „Meister-BAföG“ bekannt ist.
Wenn jemand eine Berufsausbildung nach der Handwerksordnung oder dem Berufsbildungsgesetz abgeschlossen hat, kann er die Förderung einer so genannten „Aufstiegsfortbildung“ beantragen. Es handelt sich dabei nicht nur um eine Förderung zum Meister, wie es der Name vermittelt, sondern um eine wesentlich weitergehende und viel breitere Förderung der beruflichen Weiterbildung.
Ziel der Aufstiegsfortbildung kann so die Weiterbildung zum Handwerks- oder Industriemeister, Techniker, Fachkaufmann/-frau, Fachkrankenpfleger, Betriebs-informatiker, Programmier, Betriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation sein.
Förderberechtigung
Neben Inhabern der deutschen Staatsangehörigkeit sind unter anderem auch Ausländerinnen sowie Ausländer förderberechtigt, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und über bestimmte Aufenthaltstitel bzw. über eine Daueraufenthaltserlaubnis verfügen bzw. die sich bereits drei Jahre rechtmäßig in Deutschland aufgehalten haben und erwerbstätig gewesen sind. Hierzu zählt auch die Zeit der Berufsausbildung.
Eine Altersgrenze für die Förderung besteht nicht.
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage eines Zuschusses und eines Darlehens. Nimmt man an einem Vollzeitlehrgang teil, so erhält man vom Staat einen monatlichen Beitrag zum Lebensunterhalt. Für eine verheirate Person mit 2 Kindern werden beispielsweise 1.248 € gezahlt, davon 229 € als Zuschuss und 1.019 € als Darlehen.
Weitere Kosten für den Teilnehmer der Weiterbildung fallen durch Lehrgangs- und Prüfungsgebühren an. Auch hier erhält man eine Förderung. Sie erfolgt in Höhe der tatsächlich anfallenden Gebühren, höchstens jedoch 10.226 €. Er besteht aus einem Zuschuss in Höhe von 30,5 Prozent, im Übrigen aus einem zinsgünstigen Bankdarlehen. Die gewährten Darlehen sind jeweils bis maximal 6 Jahre zins- und tilgungsfrei. Im Fall von Ali Ayhan hat der Arbeitgeber nach erfolgreicher Bewerbung auf eine interne Stellenausschreibung die gesamten Schulungskosten übernommen, entsprechend sollte man sich über die internen Regelungen zur Förderungen im Unternehmen informieren.
Wir können Sie auf dieser Webseite nur über einige wichtige Punkte zur Förderung durch das „Meister-BaföG“ informieren. Wir haben dafür auf der Grundlage der Regeln und Richtlinien, wie sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung veröffentlicht und im Internet nachzulesen sind, eine Auswahl und Zusammenfassung für Sie erstellt. Bitte nutzen Sie das ausführliche Internetangebot des Ministeriums. Sie können sich auch telefonisch an die dort genannte Informationsstelle wenden.
http://www.meister-bafoeg.info/de/36.php
|
|
YASEMİN ARPACI
Teamleiterin der Service Contract Departments, in der Fahrzeugbranche.
Yasemin Arpaci absolvierte nach dem Realschulabschluss ihr Abitur und studierte die Fremdsprachen Englisch, Französisch und Italienisch. Im Anschluss studierte sie BWL (Betriebwirtschaftslehre). Das BWL Studium verhalf ihr zum Eintritt in die Industrie.
Sie machte während ihres Studiums Praktika in verschiedenen Betrieben. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen BWL Studium arbeitete sie in verschiedenen Departments in der Türkei. Zurück in Deutschland wurde sie von einer Firma in der Fahrzeugbranche eingestellt und nun ist sie seit einem Jahr in ihrem Unternehmen als Teamleiterin beschäftigt. Die Firma übernimmt die Wartung von Kraftfahrzeugen und alle Angelegenheiten im Servicebereich (Service-Vereinbarungen).
Frau Arpaci spricht Deutsch, ihre Muttersprache Türkisch sowie Englisch, Französisch und Italienisch.
Betriebswirtschaftslehre (BWL)
Ein BWL Studium vermittelt Theorien, um verschiedene Führungsaufgaben zu übernehmen und um Unternehmen erfolgreich zu steuern. Zunächst wird Grundwissen zu den Kernbereichen wie: Controlling, Finanzen, Vertrieb, Marketing, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Produktionssteuerung, Personalwesen und Unternehmensplanung vermittelt. Dabei geht es vor allem um Projektmanagement, Analyse von Zahlen für Prozesssteuerungen und Statistiken. Auch ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten werden vorausgesetzt. Statt klassischer BWL können auch Studiengänge wie International Management, Logistik Management, Handel etc. studiert werden. All diese neuen Studiengänge weisen ein betriebswirtschaftliches Grundgerüst auf. Ein BWL-Studium eignet sich sehr gut für einen Auslandsaufenthalt. Betriebswirtschaftslehre kann man als Business Administration überall auf der Welt belegen. BWL kann auf Bachelor und Master studiert werden.
„BAföG für Studenten“
Viele Abiturienten, die sich entschließen zu studieren, stellen sich die Frage, wie sie das Studium finanzieren sollen. Eine Möglichkeit der Finanzierung ist die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Der Antrag auf BAföG sollte sofort nach der Zulassung/Einschreibung eingereicht werden. Die Höhe der Ausbildungsförderung beträgt maximal 648 € monatlich. Sie ist vom Einkommen des Studierenden im Bewilligungszeitraum und vom Vermögen des Studierenden zum Zeitpunkt der Antragstellung abhängig. Die BAföG-Förderung ist auch vom Einkommen der Eltern/ des Ehegatten abhängig. Elternunabhängige Förderung wird dann gewährt, wenn der Studierende zu Beginn des Studiums nach Vollendung des 18. Lebensjahres fünf Jahre erwerbstätig war oder wenn derjenige nach einer dreijährigen Berufsausbildung mindestens drei Jahre erwerbstätig war.
Wenn der Auszubildende (Student) bei den Eltern wohnt erhält er monatlich 414 € und wenn er nicht bei den Eltern wohnt sind es monatlich 512 €. In beiden Fällen kann sich, abhängig von der Zahlung einer Kranken- oder Pflegeversicherung, der Förderungsbetrag auf 478 € oder maximal 648 € erhöhen. Studierende mit einem eigenen Kind, das das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erhalten zusätzlich monatlich 113 €. Für jedes weitere Kind, das in einem Haushalt lebt, werden zusätzlich 85 € gezahlt. Der Zuschlag wird nur einem Elternteil gewährt. Im Jahr darf man folgendes Einkommen (Freibeträge) haben, die sich nicht auf die Höhe der Ausbildungsförderung auswirken: Ferien- oder Nebentätigkeit brutto ca. 4.800 € (mtl. 400 € Mini-Job), Praktikantenvergütung brutto 920 € oder Waisengeld, Waisenrente 1.440 €.
Der monatliche Förderungsbetrag besteht zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Darlehen. In der Regel wird über die Ausbildungsförderung für ein Jahr (Bewilligungszeitraum) entschieden. Für die BAföG-Bewilligung sind die Sachbearbeiter der einzelnen Hochschulen zuständig.
Die Rückzahlung des Darlehenanteils beginnt fünf Jahre nach dem Ende der Förderungshöchstdauer und kann in Raten bezahlt werden. Auf Antrag gibt es unterschiedliche Darlehensteilerlasse, zum Beispiel für ein besonders schnelles, erfolgreiches Studium oder bei vorzeitiger Rückzahlung, ähnlich bei Kindererziehung. Die Rückzahlung ist einkommensabhängig. Das heißt: Geringverdiener können von der Rückzahlung freigestellt werden.
Fördervoraussetzungen
Eine erste Ausbildung ist in der Regel ebenso förderungsfähig wie eine an den zweiten Bildungsweg anschließende Ausbildung oder ein Master-Studiengang, der auf einem Bachelor-Studiengang aufbaut. Die BAföG-Förderungshöchstdauer richtet sich nach der festgelegten Regelstudienzeit. Fachrichtungswechsel bis zum Beginn des 4. Fachsemesters lassen den Förderungsanspruch nicht erlöschen, wenn ein „wichtiger Grund" vorliegt.
In der Regel erhalten deutsche Studierende BAföG-Leistungen. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch ausländische Studierende diese Leistungen erhalten. Förderungsberechtigt sind Ausländer, die eine Bleibeperspektive in Deutschland haben und gesellschaftlich integriert sind. Dies sind Personen, die eine Erlaubnis auf Daueraufenthalt und eine Niederlassungserlaubnis haben.
Auszubildende können grundsätzlich nur gefördert werden, wenn sie die Ausbildung, für die sie Förderung beantragen, vor Vollendung des 30. Lebensjahres beginnen. Ausnahmeregelungen bestehen, wenn es sich um Absolventen des zweiten Bildungsweges handelt oder bei Berufstätigen ohne formelle Hochschulzugangsberechtigung, die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation an einer Hochschule eingeschrieben worden sind, oder für Personen, die aus persönlichen (z. B. Krankheit) oder familiären (z. B. Kindererziehung) Gründen gehindert waren, die Ausbildung vor Vollendung des 30. Lebensjahres zu beginnen.
Auszubildende an Höheren Fachschulen, Akademien oder Hochschulen müsse zu Beginn des 5. Fachsemesters entsprechende Leistungsnachweise vorlegen. Die Eignungsbescheinigung wird von dem hauptamtlichen Mitglied des Lehrkörpers ausgestellt. Zusätzlich muss ein kompletter Antrag auf Ausbildungsförderung eingereicht werden. Bei Ausnahmen (Schwangerschaft, Nichtbestehen der Zwischenprüfung etc.) wird ohne Vorlage der Eignungsbescheinigung für eine angemessene Zeit Ausbildungsförderung geleistet. Schreibt die Prüfungsordnungen bereits vor dem 5. Fachsemester eine Zwischenprüfung oder einen entsprechenden Leistungsnachweis vor, muss der Leistungsnachweis zur weiteren Förderung vorgelegt werden.
Auch eine BAföG-Auslandsförderung ist möglich, wenn man ein Jahr lang im Inland studiert hat. Innerhalb der EU-Mitgliedstaaten ist das gesamte Studium einschließlich Studienabschluss zu Inlandsbedingungen förderungsfähig. Außerhalb der EU kann die Ausbildung zunächst bis zu einem Jahr, insgesamt bis zu fünf Semester gefördert werden.
BAföG gibt es nicht nur für das Studium an Hochschulen, sondern auch für den Besuch anderer weiterführender Bildungsstätten. Eine Ausbildungsförderung wird nicht geleistet, wenn der Antragsteller im öffentlichen Dienst beschäftigt ist und Leistungen aus dem öffentlichen Dienst bezieht.
http://www.das-neue-bafoeg.de/de/372.php
http://www.uni-stuttgart.de/ueberblick/organisation/fakultaeten/#10
http://www.sws-internet.de/sws/bafoeg/bafoeg_start.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebswirtschaftslehre
http://www.awi.uni-heidelberg.de/bwl1/
http://www.wiwi.uni-tuebingen.de/cms/zielgruppen/studium.html
http://www.fh-heilbronn.de/studiengaenge/bu
http://fh-offenburg.de/uportal/modules/cms/files/bw/BA_W.pdf
|
|
İLYAS KABLAN
Softwareberater und Projektleiter in einem Telekommunikationsunternehmen.
Ilyas Kablan besuchte nach dem Abschluss der Realschule zwei Jahre ein Berufskolleg (Wirtschaftsschule) und machte im Anschluss sein Fachabitur. Daraufhin studierte er Wirtschaftsinformatik an einer Fachhochschule und machte ein halbes Jahr ein Praktikum in Amerika.
Die Diplomarbeit schrieb er in den Vereinigten Staaten und schloss sein Studium erfolgreich ab. Nun arbeitet er als Softwareberater und Projektleiter in einem Unternehmen für Telekommunikation und betreut eigene Projekte. Der IT-Bereich ist ein Wirtschaftszweig, der in Zukunft immer wichtiger und gefragter sein wird. Softwareberater werden in vielen Unternehmen gesucht.
Herr Kablan spricht Deutsch und Türkisch sowie Englisch in Wort und Schrift.
Wirtschaftsinformatik
Ilyas Kablan hat Wirtschaftsinformatik studiert. Wirtschaftsinformatik ist ein speziell auf die Anforderungen in der Wirtschaft gerichteter Studiengang im Fachbereich Informatik. Ein Wirtschaftsinformatiker ist in einem Unternehmen in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig, so beispielsweise in der Finanzbuchhaltung, dem Controlling oder der Logistik und leitet teilweise im Unternehmen eigenständige Projekte, wie dies auch bei Ilyas Kablan der Fall ist.
Wirtschaftsinformatik kann man an Fachhochschulen und Universitäten studieren, aber auch an Berufsakademien. Das Studium schließt man als Bachelor of Science ab. Danach gibt es die Möglichkeit den Master-Abschluss zu machen. Während des Studiums geht es um Bereiche wie: allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Controlling, Mathematik und Statistik, Software Engineering, Software-Projekte, Business-Projekte, Netzdesign, Datenbanksysteme und Programmieren. Mit diesem Wissen kann man wie Herr Kablan in der Software-IT-Branche arbeiten. Voraussetzung zu einem Studium an einer Fachhochschule ist die Fachhochschulreife, dies gilt vielfach auch für die Berufsakademie. Teilweise wird hier jedoch auch das Abitur (allgemeine Hochschulreife) verlangt, wie es für die Hochschule üblich ist. Bei einem Fachhochschulstudium ist das Studium sehr praktisch ausgerichtet. Bei einer Hochschule mehr theoretisch-wissenschaftlich. Die Berufakademie zeichnet sich durch ein duales System aus, das aus Praxis (in einem Betrieb) und Theorie (an der Berufsakademie) besteht. Bei der Berufsakademie findet die Ausbildung, ähnlich wie bei der Lehre, teilweise im Betrieb statt, mit dem ein Ausbildungsvertrag geschlossen wird und ist entsprechend auch sehr praktisch orientiert. Die Besonderheit der Berufsakademie liegt dabei darin, dass der ausbildende Betrieb (meist) über die gesamte Ausbildungszeit ein Gehalt bzw. eine Ausbildungsvergütung bezahlt.
Weitere Spezialisierungen im Fachbereich Informatik sind Medien-Informatiker, medizinischer Informatiker und technischer Informatiker. An diesen Spezialisierungen sieht man, dass die Informatik im alltäglichen Leben nahezu allgegenwärtig ist, ob wir nun in der Freizeit die vielfältigen Dienste des Internets nutzen, mit dem Navigationsgerät im Auto uns durch die Stadt lotsen lassen oder uns bei einer Bank Finanzierungspläne für eine Eigentumswohnung erstellen lassen. Die Informatikberufe gelten allgemein als sehr zukunftsorientiert.
Die verschiedenen Fachrichtungen der Informatik werden an Fach- und Hochschulen sowie an Berufsakademien angeboten. Zusammen mit den Bereichen Medien und Kommunikation sind sie in Baden-Württemberg besonders vielfältig vertreten und gelten als ein besonderes Merkmal des Bundeslandes Baden-Württemberg.
Software-IT-Branche
Die Berufaussichten im IT-Bereich sind viel versprechend, da die Nachfrage der Wirtschaft an Informatikspezialisten wie: Systemplanern, Designer und Entwicklern von Anwendungssystemen, System- und Anwendungsberatern, Projektleitern, Leiter der Informations- und Kommunikationstechnik seit Jahren ungebrochen ist. Diese qualifizierten Fachkräfte, die theoretisches und praktisches Wissen aktueller technischer Ansätze aufweisen, sind fester Bestandteil mittlerer und großer industrieller Projekte.
Die Arbeit in der IT-Branche erfordert ein hohes Maß an systematischem Denken, um die erlernten Konzepte und aktuellen technischen Lösungen flexibel in Projekte einzubringen. Ständige Weiterbildung und ein Hinterfragen von neuen Lösungsansätzen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Problemkontexte sind in diesem Bereich nötig. Je nach Eignung und Neigung bietet sich eine Vielzahl an beruflichen Einsatzbereichen und Entwicklungsmöglichkeiten an, wie: In der Software-Entwicklung in einem Software- oder Systemhaus, der Betreuung und Realisierung von Anwendungssystemen in einem Industrie-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen oder als Anwendungs- und Organisationsberater in einem Consulting-Unternehmen. Genauso kann man in der Systementwicklung/-beratung, Projektleitung oder im Informatik-Management tätig werden.
Neben analytisch technischem Wissen sind auch gute Englischkenntnisse notwendig, um gegebenenfalls internationale Projekte zu betreuen. An den Fachhochschulen gehört zum Wirtschaftsinformatik Studium auch ein Praxissemester, in dem der Studierende einen Einblick in das Berufsleben bekommt und erste praktische Erfahrungen sammelt. Ein Auslandssemester kann von Vorteil sein.
Folgende Angebote im Internet sind für eine weitere Information zu empfehlen:
http://www.ba-bw.de/babw/home.php?sprache=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Berufsakademie#Voraussetzungen_zum_Studium
http://www.dhbw-stuttgart.de/themen/studium/fakultaet-wirtschaft/wirtschaftsinformatik/konzeption-und-zielsetzung.html
http://www.doitonline.de/cms/do+it.themen/Bildung+%b6+Karriere?detailid=515&nodate=1
http://www.bwi.uni-stuttgart.de/index.php?id=905
http://www.hs-furtwangen.de/fachbereiche/wi/deutsch/studiengaenge/wirtschaftsinformatik_bachelor/?tg=0
|
|
GÖKCE KÖK
Wirtschaftsingenieurin und Projektkoordinatorin (Projekte in China und Russland).
Gökce Kök, die in der Türkei geboren und aufgewachsen ist, studierte in Istanbul Wirtschaftsingenieurwesen und kam danach nach Deutschland. In Deutschland erweitere sie ihre akademische Laufbahn durch ein erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium.
Während ihres Studiums in Deutschland nahm sie die Möglichkeit wahr, eine Zeit lang in Spanien zu studieren. Ihre Diplomarbeit schrieb sie in den Vereinigten Staaten. Als Wirtschaftsingenieurin ist sie heute in einem deutschen Unternehmen für die Koordination von Projekten in China und Russland zuständig. Dabei entwickelt sie in der Verkaufsabteilung des Unternehmens neue Systeme, Methoden und Prozesse für die Exportländer.
Frau Kök spricht Deutsch, ihre Muttersprache Türkisch sowie Englisch und Spanisch.
Wirtschaftsingenieurwesen
Gökce Kök hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das Fach Wirtschaftsingenieurwesen kann man an Hochschulen studieren (Universität, Fachhochschule und Berufsakademie). Dabei wird man in sehr unterschiedlichen Bereichen ausgebildet: Das Studium vereint naturwissenschaftlich-technisch-mathematische Kenntnisse mit kaufmännischem, juristischem, betriebs- und volkswirtschaftlichem Wissen. Neben betriebwirtschaftlichen und technischen Wissen ist auch Englisch als Fremdsprache ein wichtiger Bestandteil des Studiums. Entsprechend umfangreich ist der zu lernende Stoff. Nach dem Bachelorabschluss (Bachelor of Engineering) ist im Anschluss ein Masterstudium möglich. Internationale Berufserfahrungen können durch ein Praxissemester im Ausland gesammelt werden.
Wirtschaftsingenieure können in Industrieunternehmen aller Wirtschaftszweige sowie bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen tätig sein, insbesondere im Maschinenbau, der Elektrotechnik, im Fahrzeugbau, im Bauwesen und in Beratungsgesellschaften. Sie finden weiterhin zunehmend Beschäftigung in Versicherungen, Sparkassen und Banken. Innerhalb dieser Bereiche sind sie u.a. in Produktion, Logistik, Einkauf, Marketing und Vertrieb, Finanzverwaltung, Unternehmensführung, Technologiemanagement, Projektmanagement oder Consulting, Controlling und im Beratungsbereich tätig.
Wirtschaftsingenieurwesen ist ein sehr zukunftsorientiertes Berufsbild, da die Verknüpfung zwischen Technik und Wirtschaft in den Unternehmen immer wichtiger wird und die Ausbildung genau auf diese Doppelqualifikation gerichtet ist. In Verbindung mit Fremdsprachen ist das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens auch für international orientierte Tätigkeiten in Großunternehmen eine sehr gute Grundlage, wie beispielsweise Frau Kök erklärte.
Speziell für Absolventen, die gute Deutsch- und zugleich Türkischkenntnisse haben, könnten beispielsweise deutsche Unternehmen, die in der Türkei Standorte haben, attraktiv sein.
Empfohlene Links:
Verband der Wirtschaftsingenieure:
http://www.vwi.org/
Wikipedia (interessante Beurteilungen zum Studium, so z.B. zur Arbeitsbelastung oder Stoffvielfalt):
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsingenieurwesen#Beruf_des_Wirtschaftsingenieurs
Hochschule Pforzheim (sehr gute Darstellung von Studierenden der Hochschule):
http://www.wirtschaftsingenieurwesen.de/ http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=58677
http://www.hs-esslingen.de/de/35630
http://web.fh-heidelberg.de/de/fh-heidelberg/4853.html
|
|
GÜL ÜNSAL
Gül Ünsal arbeitet als Mechatronikerin und Maschinenführerin bei einem großen Unternehmen in Karlsruhe, das als Zentrum für Prozess-, Fertigungs-, und Gebäudeautomatisierung sowie Industrial Services gilt. Nach dem Abschluss der Werkrealschule hat Frau Ünsal vor zwei Jahren eine Ausbildung als Mechatronikerin beendet. Nun möchte sie so schnell wie möglich die Fachhochschule besuchen und dann Mechatronik studieren.
Erläuterungen zu Mechatronik
Gül Ünsal ist Mechatronikerin. Die Mechatronik setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen, deren Inhalte mechanische und elektronische Systeme sowie die Informationstechnik umfassen. Durch die Vielseitigkeit der Ausbildung gehört der Beruf des Mechatronikers zu den am meisten Nachgefragten in Deutschland und bietet gute Berufsaussichten. Nach der Ausbildung oder dem Studium zählen zu den verschiedenen Einsatzgebieten eines Mechatronikers zum Beispiel die Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder die Automobilbranche (zum Beispiel als Kfz-Mechatroniker). Den Beruf des Mechatronikers kann man entweder in einer Ausbildung oder einem Studium erlernen. Bei der Entscheidung für eine Ausbildung muss beachtet werden, dass die meisten Betriebe einen Realschulabschluss oder etwas Vergleichbares erwarten. Die Ausbildung zum Mechatroniker dauert dann in der Regel 3 ½ Jahre, kann aber in Ausnahmefällen durch gute Vorbildung oder besonders gute Leistungen während der Ausbildung verkürzt werden. Die Ausbildung findet im dualen System statt, d.h. dass der Auszubildende seinen Ausbildungsbetrieb und auch die Berufsschule besucht. Den größeren Teil der Zeit verbringt der Auszubildende im Betrieb, wo er die praktischen Teile der Ausbildung kennen lernt. Der theoretische Unterricht, der in der Regel in Blöcken stattfindet, wird dann in der Berufsschule vermittelt. Nach der Hälfte der Ausbildungszeit muss eine Zwischenprüfung und zum Abschluss der Ausbildung eine Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer abgelegt werden. Nach der Ausbildung gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel überbetriebliche Lehrgänge, die Weiterqualifizierung zum Techniker oder Meister, oder ein Ingenieursstudium im Bereich Mechatronik. Da die Mechatronik eine noch recht junge Teildisziplin ist und sich der Studiengang an deutschen Hochschulen noch im Auf- bzw. Ausbau befindet, wird das Lehrangebot beinahe täglich erweitert. Der Begriff Mechatronik steht im Allgemeinen für interdisziplinäres Herangehen bei der Entwicklung, Produktion und Vermarktung zeitgemäßer Produkte und Systeme. Da sie gerade für den technologischen Fortschritt unverzichtbar ist, gehört die Mechatronik von Anfang an zu den Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Daher verwundert es auch nicht, dass sie aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken ist und bereits bis in die Bereiche der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, und sogar bis zu Kommunikationstechnik, Spielzeug und Haushaltsgeräten reicht. Den Beruf des Mechatronikers kann man sowohl in einer Ausbildung als auch in einem Studium erlernen. Angeboten wird das Studium an Fachhochschulen, Hochschulen und Dualen Hochschulen (früher: Berufsakademie). In Baden-Württemberg gibt es insgesamt acht Duale Hochschulen an folgenden Standorten: Heidenheim, Karlsruhe, Lörrach, Mannheim, Mosbach (und Campus Bad Mergentheim), Ravensburg (und Campus Friedrichshafen), Stuttgart und Villingen-Schwenningen.
Ausbildung:
Mechatronik-portal.de: Informationsplattform zum Thema Mechatronik
http://www.mechatronik-portal.de/mechatronik_ausbildung.php
BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=2868
Bildung-news.com: der tägliche Bildungs- und Karriereblog
http://www.bildung-news.com/bildung-und-karriere/ausbildung-und-lehre/ausbildung-zum-mechatroniker//
Hochschulen / Fachhochschulen/ Duale Hochschulen:
Berufe Portal:
http://www.berufe-portal.de/metall-berufe/berufsbeschreibungen/mechatronikerin/
(Fach-) Hochschule und Weiterbildungsportal Deutschland:
http://www.fachhochschule.de/FH/Fachhochschule/Baden-Wuerttemberg/technik/Mechatronik.htm
Mechatronik-portal.de: Informationsplattform zum Thema Mechatronik
http://www.mechatronik-portal.de/mechatronik_studium.php
Studien.de
http://studieren.de/mechatronik.0.html
|
|
HAKAN KARINCALI
Hakan Karincali ist 20 Jahre alt, wurde in Stuttgart geboren und hat zwei ältere Schwestern. Nach der Grundschule hat er die Realschule in Stuttgart besucht und direkt im Anschluss daran eine Ausbildung zum Mechatroniker begonnen. Mittlerweile ist Hakan Karincali im zweiten Ausbildungsjahr und arbeitet in seinem Ausbildungsunternehmen hauptsächlich mit Maschinen, für deren Reparaturen er auch verantwortlich ist. Nach der Ausbildung strebt er eine Weiterbildung zum Techniker* an, die insgesamt vier Jahre dauern wird und durch die er seine Jobchancen verbessern möchte. Siehe: Ausbildung zum Mechatroniker: Text schon mal geschrieben für Gül Ünsal
*Techniker
Ein staatlich geprüfter Techniker verfügt einerseits über praktische Berufserfahrung und andererseits über fundiertes, theoretisches Fachwissen. Durch dieses umfangreiche Wissen ist er/sie in seiner/ihrer Fachrichtung in einem breiten Feld einsatzfähig und kann sich auch veränderten Anforderungen anpassen. Im Rahmen einer Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker (z.B. beim DAA-Technikum) können folgende Fachrichtungen und Schwerpunkte belegt werden: Bautechnik (Hoch- oder Tiefbau); Elektrotechnik (Datenverarbeitungstechnik, Energie- und Automatisierungstechnik); Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Holztechnik; Informatik; Maschinen(bau)technik (Betriebstechnik oder Konstruktionstechnik) sowie Metallbautechnik.
Der Techniker kann an einer Fachschule für Technik, entweder in einem Teilzeitstudium neben der Arbeit (berufsbegleitend vier Jahre lang / Wöchentlich ca. 16 Stunden) oder innerhalb von zwei Jahren in einem Vollzeitstudium, erlernt werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an einem Fernlehrgang (z.B. bei ILS) ist entweder ein Abschluss der Berufsschule und eine fachlich geeignete Berufsausbildung, oder ein Berufsschulabschluss und eine fachlich geeignete Berufspraxis von mindestens dreieinhalb Jahren.
Um am Ende die staatliche Technikerprüfung ablegen zu dürfen, wird ein Nachweis über den erfolgreichen Abschluss an einer Berufsschule, sowie ein Nachweis über eine fachlich geeignete Berufsausbildung und der entsprechenden Berufspraxis von fünf Jahren (wobei die berufliche Ausbildungszeit hier mit eingerechnet wird) benötigt. Möglich ist auch der Nachweis einer fachlich geeigneten Berufspraxis von sieben Jahren. Des Weiteren wird zur Zulassung noch der Nachweis einer ausreichenden Vorbereitung erforderlich, der durch das Fernstudium und der damit verbundenen Teilnahme an Seminaren und Vornotenklausuren erworben werden kann.
Insgesamt setzt sich die staatliche Abschlussprüfung aus drei Grundlagen- und vier fachrichtungsbezogenen Prüfungsfächern sowie aus einer Projektarbeit zusammen. Um diese Anzufertigen, muss ein Thema fachübergreifend und praxisbezogen bearbeitet werden.
Wurde der Fernlehrgang erfolgreich abgeschlossen, erhält der Teilnehmer ein Abschlusszeugnis und darf nun die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Techniker“ führen.
http://www.daa-technikum.de/lehrgaenge/index.php3
http://www.ils.de/technik_meister.p
|
|
DOĞAN EŞİYOK
Dogan Esiyok ist 29 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind. Er wurde in der Türkei geboren und kam – nach der 1. Klasse - im Alter von sieben Jahren nach Deutschland. Nach der Grundschule in Stuttgart besuchte er die Realschule, die er mit der mittleren Reife abschloss. Anschließend wechselte er auf ein technisches Gymnasium*, an dem er auch sein Abitur machte. Nach Beendigung seiner Schulzeit hat Dogan Esiyok innerhalb von zwei Jahren eine Ausbildung zum Fachinformatiker absolviert. Nach seiner Ausbildung hat er eine Tätigkeit in einem Ausbildungszentrum übernommen und dort nach einem Jahr auch erfolgreich die Prüfung für Ausbilder bestanden. Danach hat er weiter in diesem Bereich als Ausbilder gearbeitet und Kurse für die Auszubildenden seiner Firma geleitet. Anschließend hat Herr Esiyok, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, in der Abteilung für Entwicklung begonnen.
Erläuterungen zu Dogan Esiyok bzw. zum Fachinformatiker
Dogan Esiyok hat eine Ausbildung zum Fachinformatiker absolviert. Dieser zählt zu den IHK-Ausbildungsberufen und beinhaltet die Fachbereiche Informatik und Informationstechnologie. Nicht verwechselt werden sollte der Begriff mit dem des Informatikers, da für diesen Beruf ein Studium absolviert werden muss. Dennoch können Fachinformatiker praktisch in jedem Bereich eingesetzt werden, da in der heutigen Zeit so gut wie alle Unternehmen auf Computer angewiesen sind und vor allem deren sinnvoller Einsatz wichtig ist. Daher arbeiten sie hauptsächlich in Unternehmen, die Computertechnik und Informations- und Telekommunikations-Systeme (IT-Systeme) herstellen oder die für andere Firmen Dienstleistungen aus diesem Technikbereich anbieten. Alles in allem konzipieren und realisieren Fachinformatiker also komplexe Hard- und Softwaresysteme und passen diese auf die Benutzer an.
Eingangsvoraussetzung für eine Ausbildung zum Fachinformatiker ist in den meisten Fällen die Mittlere Reife, manche Unternehmen bestehen jedoch auch auf die allgemeine Hochschulreife. Die Ausbildung selbst findet im dualen System statt, was bedeutet, dass der/die Auszubildende sowohl den Ausbildungsbetrieb als auch die Berufsschule besucht.
Die ersten beiden Jahre der Ausbildung laufen noch identisch ab, bis sich die Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr in einer Fachrichtung spezialisieren müssen: entweder werden sie Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung (FIAE) oder Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration (FISI). Die Anwendungsentwickler arbeiten allgemein mehr Software-bezogen und planen, entwickeln und präsentieren demnach die Software. Die Systemintegratoren hingegen arbeiten eher im Hardwarebereich, weswegen sie überwiegend in der Netzwerk- und Systemadministration zu finden sind. Zu den gemeinsamen Kernqualifikationen der beiden Fachrichtungen gehören: Datenbanktehorie, -entwurf und –abfrage, moderne Analyse- Entwurfs- und Implementierungsmethoden in der objektorientierten Softwareentwicklung sowie der Systemtechnik, außerdem umfassende Kenntnisse betriebswirtschaftlicher Analyse, Steuerung und Kontrolle und letztlich Projektplanung und Kommunikationstechniken.
Trotz der Spezialisierung nach Fachrichtungen zählt der Beruf des Fachinformatikers zu den Generalistenausbildungen, da zwar Fachthemen in der Tiefe vermittelt werden, zusätzlich aber eben auch betriebswirtschaftliche, arbeits- und kommunikationspsychologische Kenntnisse. Erst dadurch ist es möglich, in Unternehmen die Anforderungen von Kunden und Märkten effizient abzudecken. Die Ausbildungsdauer beträgt im Regelfall drei Jahre, sie kann jedoch, wie im Falle von Dogan Esiyok, - aufgrund besonders guter Leistungen, oder der allgemeinen Hochschulreife - auf bis zu zwei Jahre verkürzt werden. Dafür ist jedoch immer die Zustimmung des Ausbildungsbetriebs und der zuständigen Industrie- und Handelskammer notwendig.
Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einer schriftlichen Prüfung, einem realen betrieblichen Abschlussprojekt (zwischen 35 und 70 Stunden), einer schriftlichen Dokumentation und einer mündlichen Präsentation des Abschlussprojekts sowie einem Fachgespräch über das Projekt vor einem IHK-Prüfungsausschuss.
Nach Beendigung der Ausbildung stehen verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bei einem Realschulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum Fachinformatiker besteht die Möglichkeit den Techniker zu machen. Ist der Absolvent jedoch im Besitz der Fachhochschulreife oder des Abiturs, kann er nach Beendigung der Ausbildung ein Studium an der Fachhochschule beziehungsweise an der Universität beginnen. Möglich ist zum Beispiel ein Studium zum Betriebswirt, Informatiker oder auch Wirtschaftsinformatiker.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachinformatiker
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=13814
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Ausbildung-und-Beruf/ausbildungsberufe,did=68534.html
http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_1840.htm
|
|
ALİYE DURAN
Aliye Duran ist in Mannheim aufgewachsen und lebt, zusammen mit ihren beiden Kindern, noch heute dort. Bereits während ihrer Schulzeit hat sie als Aushilfe im Geschäft ihres Vaters gearbeitet. Nach dem Realschulabschluss hat Frau Duran eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert und anschließend die Prüfung zum Ausbilder der Auszubildenden (AdA) gemacht. Im Jahr 1988 hatte sie dann die Gelegenheit die Boutique ihres Vaters zu übernehmen und bildet dort seither auch in drei Berufen - Verkäuferin, Einzelhandelskauffrau und Bürokauffrau - aus.
Einzelhandelskauffrau
Einzelhandelskauffrau ist ein ehemaliger Ausbildungsberuf, der im Jahr 2004 durch den Nachfolgeberuf Kauffrau im Einzelhandel ersetzt wurde. Eine nähere Beschreibung zu diesem Ausbildungsberuf finden Sie bei Saziye Sahin.
Ausbildung der Ausbilder (AdA)
Aliye Duran hat sich nach ihrer Ausbildung zum Ausbilder weiterbilden lassen. Diese Ausbildung der Ausbilder (AdA) erfolgt entweder Vollzeit, berufsbegleitend oder als Fernlehrgang und kann – je nach Bildungsanbieter und Art des Lehrgangs - bis zu 11 Monate betragen. Durchgeführt werden die Lehrgänge von Berufsakademien und privaten Bildungsträgern, Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern. Im Rahmen einer neuen Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO), die am 01. August 2009 in Kraft getreten ist, wurden vier Handlungsfelder eingeführt, die den heutigen Anforderungen an die Ausbilder besser entsprechen und sich direkt am Ablauf der Ausbildung orientieren:
1) Ausbildungsvoraussetzung prüfen und Ausbildung planen,
2) Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken,
3) Ausbildung durchführen und
4) Ausbildung abschließen
Um an der Ausbilder-Eignungsprüfung teilzunehmen zu dürfen, muss der Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine praktische Tätigkeit, die über eine angemessene Zeit erfolgt ist, erbracht werden. Anders als vor Einführung der neuen Verordnung sind Ausbilder nun wieder dazu verpflichtet, die Eignungsprüfung auch wirklich abzulegen. Denn erst die bestandene Prüfung gilt bundesweit als einzig anerkannte und einheitliche Qualifikation zum Nachweis der benötigten berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse. Die Abschlussprüfung zum Ausbilder besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Die schriftliche Prüfung beinhaltet Multiple-Choice-Fragen aus mehreren Handlungsfeldern. Die praktische Prüfung hingegen setzt sich aus einer Ausbildungseinheit, die der Prüfungsteilnehmer selbst auswählt, und einem Prüfungsgespräch zusammen. In diesem Gespräch hat der Prüfungsteilnehmer die Aufgabe, seine Auswahl und Gestaltung der Ausbildungseinheit zu begründen. Das Ziel der Prüfung besteht darin, dass der Bewerber seine Fähigkeit zum selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Ausbildung nachweisen kann. Als bestanden gilt eine solche Prüfung, wenn sowohl im schriftlichen als auch im praktischen Bereich eine Leistung erbracht wurde, die mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde. Zu den späteren Hauptaufgaben eines Ausbilders gehört es, den Auszubildenden zu einem qualifizierten Mitarbeiter zu schulen, indem er sich um dessen Entwicklung von Fach-, Methoden-, Persönlichkeits- und Sozialkompetenz kümmert.
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/resultList.do?searchString=A&resultListItemsValues=9673_9657&suchweg=alpha&doNext=forwardToResultShort
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=9673
http://www.stuttgart.ihk24.de/produktmarken/aus_und_weiterbildung/weiterbildung/IHK_Fortbildungspruefungen/Der_Weg_zur_Ausbilder-Eignungspruefung.jsp
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1235
http://www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplus.html?artid=710
|
|
FATİH KASIMOĞLU
ist 36 Jahre alt, wurde in Stuttgart geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Abschluss der Realschule hat er eine Ausbildung als Industrieelektroniker Fachrichtung Produktionstechnik absolviert. Von seinem Ausbildungsbetrieb wurde er danach als Betriebselektriker eingestellt und verbrachte anschließend in dessen Auftrag acht bis neun Monate in Spanien und Italien. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde Herr Kasimoglu vorerst in der Abteilung für neue Erfindungen (ARGE) eingestellt, wechselte dann jedoch in die Fertigung. Zeitgleich hat er seinen Meister mit dem Schwerpunkt Mess- und Steuerregelungstechnik* gemacht und arbeitet nun bereist seit zehn Jahren auch als Ausbilder. Das Ziel von Fatih Kasimoglu ist es, den Bachelor of Engineering durch ein Fernstudium zu erlangen und anschließend noch seinen Master zu machen.
Industrieelektroniker Fachrichtung Produktionstechnik
Bis zum Jahr 2003 wurde der Ausbildungsberuf des Industrieelektronikers angeboten, der in die beiden Fachrichtungen Produktionstechnik und Gerätetechnik untergliedert ist. Noch heute arbeiten Industrieelektroniker der Fachrichtung Produktionstechnik an automatisierten Anlagen (zum Beispiel Fertigungsstraßen und Industrieroboter) in der Industrie. Zu ihren Einsatzorten gehören meist die Montage, Qualitätssicherung und Instandhaltung in großen Industriebetrieben. Industrieelektroniker der Fachrichtung Gerätetechnik hingegen stellen mechanische, elektromechanische und elektronische Bauteile und Geräte her. Zu ihren Einsatzorten gehören häufig die Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung und Qualitätssicherung in mittleren und großen Industriebetrieben. Da in beiden Bereichen jedoch seit dem 1. August 2003 nicht mehr ausgebildet wird, wurden sie noch im selben Jahr durch neue Ausbildungsberufe ersetzt. So wurde der Industrieelektroniker Fachrichtung Produktionstechnik abgelöst vom Elektroniker für Automatisierungstechnik (eine nähere Beschreibung der Ausbildung ist bei Ugur Öztürk nachzulesen) und der Industrieelektroniker Fachrichtung Gerätetechnik vom Elektroniker für Geräte und Systeme. Weitere Industrielle Elektroberufe aus diesem Bereich sind der Elektroniker für Betriebstechnik, der Mechatroniker und seit dem Jahr 2009 der neue Ausbildungsberuf des Industrieelektrikers.
http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=2753
http://www.jumpforward.de/index.php?&page=berufenetdetail&BKZ=2881&
Meister Schwerpunkt Mess- und Steuerregelungstechnik Industriemeister Fachrichtung Elektrotechnik (Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)
Industriemeister der Fachrichtung Elektrotechnik ist – laut Berufsbildungsgesetz (BBiG) – eine berufliche Weiterbildung, die folgende Bereiche beinhaltet:
- Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikation: Methoden der Information, Kommunikation und Planung; Zusammenarbeit im Betrieb, Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen, Rechtsbewusstes und betriebswirtschaftliches Handeln sowie die Ausbildung zum Ausbilder
- Technik: Infrastruktursysteme und Betriebstechnik sowie Automatisierungs- und Informationstechnik
- Organisation: Planungs-, Steuerungs- und Kommunikationssysteme; Betriebliches Kostenwesen sowie Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz
- Personal und Führung: Personalführung und –entwicklung sowie
Vorbereitungslehrgänge für die Prüfung zum Industriemeister für Elektrotechnik werden als Teilzeit-, Vollzeit- oder Fernstudium angeboten, die Teilnahme ist jedoch nicht verpflichtend.
Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung ist entweder eine bestandene Prüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Fachrichtung Elektrotechnik sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung. Oder eine erfolgreich abgelegte Prüfung in einem anderen gewerblich-technischen oder handwerklichen Ausbildungsberuf und ein Nachweis über mindestens 18 Monate Berufserfahrung. Eine Zulassung ist außerdem auch möglich, wenn insgesamt eine fünfjährige Berufserfahrung nachgewiesen werden kann.
Nach der bestandenen Prüfung besteht zusätzlich noch die Möglichkeit sich zum Technischen Betriebswirt weiter zu qualifizieren, oder ein Hochschulstudium – zum Beispiel ebenfalls im Bereich Elektrotechnik – zu beginnen. In manchen Fällen ist dies sogar ohne Hochschulzugangsberechtigung möglich.
Zu den Aufgaben von Industriemeistern der Fachrichtung Elektrotechnik gehört neben der Planung einzelner Arbeitsschritte, der Ermittlung des Materialbedarfs und der Erstellung von Vorgaben zur Konfiguration von elektrotechnischen Systemen auch die Sorge für die Einsatzbereitschaft der Betriebs- und Arbeitsmittel. Zu ihrem Verantwortungsbereich zählt dabei das Erreichen gesetzter Produktionsziele in Bezug auf Menge, Qualität, Termin und Wirtschaftlichkeit, die Erstellung und Einhaltung von Kosten- und Kapazitätsplänen und die Einleitung von Optimierungsprozessen zur Produktivitätssteigerung des Betriebes. Außerdem sind sie auch für die Qualitätssicherung zuständig.
Nach der Weiterbildung arbeiten Industriemeister der Fachrichtung Elektrotechnik in Betrieben der Elektroindustrie und sind dort überwiegend mit Fach- und Führungsaufgaben in der Planung und Fertigung beschäftigt. Sie übernehmen die professionelle Leitung und somit auch die Verantwortung bei der Überwachung von industriellen Fertigungen. Aus diesem Grund arbeiten sie sowohl im Büro als auch in der Fertigung selbst, wo sie qualifizierte Arbeitskräfte zur Pflege einteilen und sich um die Instandhaltung der Fertigung kümmern.
Zu den späteren Berufsfeldern von Industriemeistern der Fachrichtung Elektrotechnik gehören zum Beispiel Rundfunkveranstalter, Unternehmen des Maschinen- und Werkzeug- oder Fahrzeugbaus (besonders im Bereich der Fahrzeugelektronik), Hersteller von Computern und elektromedizinischen Geräten und Instrumenten oder auch Hersteller von Elektromotoren.
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=6204
http://www.vdv-karriere.de/index.php?id=industriemeister_elektrotechnik
|
|
UĞUR ÖZTÜRK
Ugur Öztürk ist 22 Jahre alt und wurde in Karlsruhe geboren. Aufgewachsen ist er in Bruchsal, wo er auch zur Schule gegangen ist. Nach der Hauptschule hat sich Ugur Öztürk für den weiteren Besuch einer Werkrealschule* entschieden und anschließend – innerhalb von drei Jahren - eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik absolviert. Zusätzlich hat das Unternehmen Herrn Öztürk ermöglicht, zu seiner Ausbildung noch das Berufskolleg* abzuschließen und dadurch auch die Fachhochschulreife zu erlangen. Dies war ihm sehr wichtig, um später auch Aufstiegschancen wahrnehmen zu können.
Erläuterungen zu Ugur Ötztürk bzw. zum Elektroniker für Automatisierungstechnik
Ugur Ötztürk hat drei Jahre lang eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik absolviert. Seit dem Jahr 2003 ist Elektroniker für Automatisierungstechnik in Deutschland ein anerkannter Industrieller Elektroberuf, der sowohl in der Industrie als auch im Handwerk ausgeübt werden kann. In der Industrie arbeiten Elektroniker für Automatisierungstechnik für Unternehmen, die Automatisierungslösungen entwickeln, herstellen oder einsetzen und die meist aus der Elektroindustrie oder dem Bereich des Maschinenbaus stammen. Im Bereich des Handwerks hingegen arbeiten sie häufig bei Herstellern von industriellen Prozesssteuereinrichtungen, in Wasser- und Klärwerken beziehungsweise in Recyclinganlagen der Abfallwirtschaft oder sie sind in Betrieben für die Elektroinstallation zuständig.
In beiden Fällen findet die Ausbildung jedoch im dualen System, also im Betrieb und auch in der Berufsschule, statt. Den Schwerpunkt der Ausbildung bildet der Bereich der Automation von Industrieanlagen, wozu die Steuerungstechnik (SPS und VPS), die Mess- und Regeltechnik, Antriebstechniken und letztlich auch die Sensorik und Aktorik gehören. Insgesamt beträgt der Ausbildungszeitraum zwischen drei und dreieinhalb Jahren, kann jedoch - unter bestimmten Voraussetzungen* - auf bis zu zweieinhalb Jahren verkürzt werden. Nach den ersten eineinhalb Jahren der Ausbildung muss allerdings bereits der erste Teil der Abschlussprüfung abgelegt werden, der schon 40 Prozent zum Facharbeiterbrief hinzu zählt.
Alles in allem zählen Elektroniker der Fachrichtung Automatisierungstechnik zu den Spezialisten für die Automatisierung von gebäudetechnischen Prozessabläufen und Fertigungssystemen. Sie integrieren Automatisierungslösungen, nehmen diese in Betrieb und halten sie in Stand. Zu den typischen Einsatzfeldern zählen unter anderem: Produktions- und Fertigungsautomaten, Verfahrens- und Prozessautomation, Netzautomation, Verkehrsleitsysteme sowie Gebäudeautomation. Zu den späteren Arbeitsbereichen gehören zum Beispiel die Automobilindustrie, die chemischen Industrie oder Kunststoff verarbeitende Betriebe.
Sollte es Probleme geben, einen Ausbildungsplatz als Elektroniker für Automatisierungstechnik zu bekommen, gibt es noch folgende Alternativberufe, die vergleichbare Ausbildungs- bzw. Tätigkeitsinhalte haben: Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Elektroniker Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik, Mechatroniker oder Systemelektroniker.
Industrie:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=15630
Handwerk:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=15640
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=15640
Allgemein:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroniker_f%C3%BCr_Automatisierungstechnik
http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_10541.htm
|
|
SULTAN KURUOVA
Sultan Kuruova ist 21 Jahre alt, wurde in Bad Urach, in der Schwäbischen Alb, geboren und hat dort bis zur neunten Klasse die Hauptschule besucht. Anschließend war sie für zwei Jahre auf einer Sozialpädagogischen Hauswirtschaftsschule in Münzingen, wo sie auch die Mittlere Reife abgeschlossen hat. Danach hat Sultan Kuruova sich in ihrem Heimatort bei einem Gesundheitszentrum um einen Ausbildungsplatz zur Hotelfachfrau beworben. Vor kurzem hat sie diese abgeschlossen und arbeitet nun im Restaurantbereich des Zentrums. Das Ziel von Frau Kuruova ist eine Beförderung zur Abteilungsleiterin.
Hotelfachfrau/-mann
Sultan Kuruova hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert. Hotelfachfrauen/–männer sind wahre Allrounder, die nach ihrer Ausbildung in allen Abteilungen eines Hotels mitarbeiten können. Da ihre Arbeit zu den Dienstleistungsberufen gehört, sind sie für das Wohl ihrer Gäste verantwortlich und haben die Aufgabe, sich vor, während und nach deren Anwesenheit um sie zu kümmern. Größtenteils arbeiten Hotelfachfrauen/-männer in Hotels, Gasthöfen und Pensionen, aber auch in Restaurants, Cafés, Kaufhäusern, Ferienparks oder Diskotheken.
Der Beruf der/des Hotelfachfrau/-manns existiert bereits seit 1980, wurde jedoch im Jahre 1998 neu gegliedert. Die Ausbildung findet im dualen System, oder rein schulisch, statt und dauert insgesamt drei Jahre, wobei eine Verkürzung der Ausbildungsdauer in der Regel nicht möglich ist. Zugangsvoraussetzung ist mindestens ein Hauptschulabschluss, besser jedoch ein Realschulabschluss oder Abitur.
Während ihrer Ausbildung durchlaufen die Lehrlinge alle relevanten Abteilungen, von der Etage (Housekeeping), dem Empfang (Rezeption), der Reservierung und dem Verkauf (Sales) bis hin zur Veranstaltungsabteilung (Bankett-Büro), dem Service und der Küche. Aus diesem Grund sind Hotelfachfrauen/-männer grundsätzlich in allen Bereichen eines Hotels einsetzbar, sowohl im Restaurant und Zimmerservice als auch in der Verwaltung, wo sie sich unter anderem um Lagerhaltung, Personalwesen und Buchhaltung kümmern müssen.
Da Hotelfachkräfte stressresistent sein sollten und sich auf regelmäßigen Wochenend- und Schichtdienst einstellen müssen, ist es ratsam vor der Entscheidung für diesen Beruf ein Praktikum zu absolvieren.
Gerade im Hotelfach ist eine permanente Weiterbildung unausweichlich, wobei die entsprechenden Qualifikationen häufig durch Fachseminare erworben werden können, die vom Service bis zum Finanz- und Rechnungswesen reichen können.
Es gibt jedoch auch Weiterbildungsmöglichkeiten die eine mehrjährige Berufserfahrung voraussetzen, wie die Weiterbildung zum Hotelmeister, Hotelbetriebswirt, staatlich geprüfter Gastronom oder Betriebswirt, Fachwirt im Gastgewerbe, Restaurant- oder Betriebsleiter. Zusätzlich besteht auch noch die Option, ein Studium zum Diplom-Betriebswirt im Bereich Tourismus, Hotel- und Gaststättenwesen zu absolvieren, wobei hierfür eine Hochschulberechtigung notwendig ist.
Zusätzlich bestehen noch Aufstiegsmöglichkeiten zum Abteilungsleiter, Hoteldirektor oder selbstständigen Unternehmer eines eigenen Betriebes.
In Baden-Württemberg besteht speziell für Abiturienten die Möglichkeit, den Ausbildungsgang Hotelfachfrau/-mann um die Zusatzqualifikation Hotelmanagement zu erweitern. Ziel dieser Qualifikation ist es, Hotelfachleute auszubilden, die über eine hohe Kommunikations- und Managementkompetenz verfügen und fähig dazu sind, Gäste aus dem In- und Ausland zu betreuen. Zu den Ausbildungsinhalten gehören daher neben dem Management im Gastgewerbe auch die Bereiche Recht und berufsbezogene Fremdsprachen. Am Ende der Ausbildung muss für die Zusatzqualifikation neben der regulären Abschlussprüfung zur/zum Hotelfachfrau/-mann noch eine schriftliche und praktische Zusatzprüfung absolviert werden.
In Baden-Württemberg erfolgt die theoretische Ausbildung im dualen System an den folgenden vier Berufsschulen: Paul-Kerschensteiner-Schule Bad Überkingen, Gewerbliche Schule Calw, Claude-Dornier-Schule Friedrichshafen (jetzt Außenstelle Tettnang) und Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen-Schwenningen.
Sofern die Erstausbildung nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, besteht in der Regel noch zusätzlich die Option, eine Weiterbildung zur Europaqualifikation zu absolvieren. Vorgesehen ist hierfür entweder ein Auslandsaufenthalt von jeweils sechs Monaten oder zwei Auslandsaufenthalte von jeweils drei Monaten im Hotel- und Gaststättenbereich. Zu Beachten ist dabei, dass die Auslandsaufenthalte nur in fremdsprachigen Ländern der Europäischen Union und in der fremdsprachigen Schweiz erfolgen können. Um die Europaqualifikation zu erlangen, muss letztlich eine Prüfung absolviert werden, die sich aus einer Facharbeit, einer mündlichen Präsentation der Facharbeit in der gewählten Fremdsprache und einem Fachgespräch über Inhalte der Facharbeit in deutscher Sprache zusammensetzt.
Ausbildung zur/zum Hotelfachfrau/-mann
http://www.bildung-news.com/bildung-und-karriere/ausbildung-und-lehre/ausbildung-zur-hotelfachfrau-bzw-zum-hotelfachmann/
http://www.bewerbung-forum.de/hotel-gastgewerbe/ausbildung-hotelfachfrau.html
http://berufe.hotel-intern.de/index.php?beruf=hotelfachfrau
http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_2156.htm
Zusatzqualifikationen: Hotelmanagement und Europaqualifikation
http://www.landesberufsschule.de/eq/pruefungsmodalitaeten.htm
http://www.landesberufsschule.de/berufe/hotelmanagement.html
http://www.hotel-career.at/fort_und_weiterbildung/e.html
http://www.dehoga.org/hogainf.nsf/ea007d5463dad9edc12566800050c124/cc97cfb3e841b55ac12562cf0037a074?OpenDocument
|
|
SERKAN AYDIN
Serkan Aydin ist 33 Jahre alt und seit zwei Jahren verheiratet. Geboren wurde er in Dillingen an der Saar, zog jedoch im Alter von zwölf Jahren gemeinsam mit seiner Familie nach Stuttgart, wo er auch zur Schule ging. Herr Aydin hat eine Ausbildung zum Bäcker absolviert und von 1996 bis 2000 die Teilhaberschaft an der Bäckerei eines Freundes übernommen. Im Jahre 2000 konnte er sich dann, durch die Pacht einer eigenen Bäckerei, selbstständig machen. Seit 2007 darf Serkan Aydin ausbilden, womit er noch im selben Jahr begonnen hat.
Ausbildung zum Bäcker
Serkan Aydin hat eine Ausbildung zum Bäcker absolviert. Dieser Beruf wird sowohl im Handwerk als auch der Industrie angeboten, weshalb Bäcker entweder im Nahrungsmittelhandwerk oder aber in der Nahrungsmittelindustrie, zum Beispiel in einer Großbäckerei, arbeiten. Zusätzlich haben sie auch noch die Möglichkeit in Spezial- und Diät-Bäckereien, im Catering-Bereich oder aber in der Gastronomie zur arbeiten. Nach ihrer Ausbildung sind Bäcker in der Lage, eine große Auswahl an anspruchsvollen ernährungs-, genuss- und gesundheitsorientierten Backerzeugnissen herzustellen. Bedacht werden muss bei diesem Beruf jedoch, dass die Arbeit körperlich anstrengend ist und Bäcker sehr früh aufstehen müssen. Eine Ausbildung zum Bäcker findet meistens im dualen System statt und dauert insgesamt drei Jahre. Während das erste Ausbildungsjahr der Lehrlinge mit der Aneignung von einfachen Backkenntnissen (z.B. für das Backen von Weizenbroten und Brötchen und für die Herstellung von Cremes und Füllungen), der Qualitätssicherung, Hygienevorschriften und der Lagerung von Lebensmitteln beginnt, wird das Erlernte im zweiten und dritten Lehrjahr weiter vertieft. Zusätzlich dazu erhalten die Auszubildenden noch einen kleinen Einblick in die Konditorei und müssen außerdem Lernen Salate, Toast, Gemüsekuchen und Quiches herzustellen. Und auch Rezepturprüfungen, die betriebliche Dokumentation sowie die Beherrschung der Grundlage der betrieblichen Kalkulation gehören zu den Ausbildungsinhalten. Nach der Hälfte der Ausbildung wird eine Zwischenprüfung abgelegt, deren Bestehen Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung ist. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung gibt es durch die Weiterbildung zum Techniker oder Meister noch weitere Aufstiegsmöglichkeiten. Möglich ist außerdem die Selbstständigkeit – wie bei Serkan Aydin – die jedoch einen Eintrag in der Handwerksrolle* voraussetzt.
Ausbildung zur/zum Hotelfachfrau/-mann
http://www.studium-ausbildung.com/baecker-ausbildung.html
http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_15412.htm
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=3626
|
|
ŞERAFETTİN DEĞER
Şerafettin Deger wurde 1963 in Adana geboren und kam 1979, im Alter von 16 Jahren, nach Deutschland. Heute hat er zwei Kinder und lebt in Mannheim. Nach seiner Ankunft in Deutschland war Herr Deger zunächst als Arbeiter beschäftigt, bis er - innerhalb von zwei Jahren - eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur absolvierte. Nach seiner Ausbildung begann er in diesem Beruf zu arbeiten, bis er sich entschloss seinen Meister zu machen. Serafettin Deger entschied sich für eine Schule mit Vollzeitunterricht, in der er innerhalb eines Jahres seinen Meisterbrief erlangte. Geholfen hat ihm dabei vor allem die finanzielle Unterstützung durch das Meister-BAföG*, mit dessen Rückzahlung Herr Deger so lange warten konnte, bis er sich selbstständig gemacht und somit auch ausreichend Geld verdient hat.
Gas- und Wasserinstallateur = heute: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (Anlagenmechaniker SHK)
Beim Beruf des Gas- und Wasserinstallateurs, den Serafettin Deger noch erlernt hat, handelt es sich um einen ehemaligen Ausbildungsberuf, der im Jahre 2003 durch den Nachfolgeberuf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) abgelöst wurde.
Anlagemechaniker SHK planen und installieren versorgungstechnische Anlagen und sind auch für deren Wartung und Instandsetzung verantwortlich. Sie arbeiten unter anderem in Klempnereien, Installationsbetrieben, Solar- und Regenwasserschutzanlagen sowie bei Unternehmen, die Heizungs- und Klimaanlagen bauen.
Der neue Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers SHK stellt eine attraktive Berufsperspektive dar, da er sowohl handwerklich Begabten als auch Technikinteressierten einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag bieten kann. Es handelt sich also um einen technologisch anspruchsvollen Ausbildungsberuf, der vielseitiges Wissen und Können erfordert.
Die Ausbildung kann sowohl im Handwerk und als auch in der Industrie durchgeführt werden. Sie dauert insgesamt dreieinhalb Jahre und findet im dualen System oder auch rein schulisch statt. Da der Beruf des Anlagenmechanikers SHK zu den Monoberufen ohne Fachrichtungen zählt, ist die Ausbildung in den ersten beiden Jahren der beruflichen Fachstufe für alle Auszubildenden einheitlich und beinhaltet überwiegend einfache Instandhaltungsmaßnahmen. Differenzierungsmöglichkeiten bestehen erst durch die Fachaufgaben in den ausgewiesenen Handlungsfeldern Wasser-, Luft-, Wärme- oder Umwelttechnik/Erneuerbare Energien. Eine solche Vertiefung wird jedoch vom Ausbildungsbetrieb festgelegt und findet häufig erst im dritten oder vierten Ausbildungsjahr statt.
Neu an dem Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker SHK sind die Anwendung nachhaltiger Energietechniken und vor allem der verlagerte Schwerpunkt von den rein handwerklichen hin zu den mehr dienstleistungsorientierten Tätigkeiten (also der Orientierung am Kunden). Zusätzlich wurden auch die Bereiche der Qualitätsmanagementsysteme und der Elektrotechnik stark ausgeweitet. Gerade der letzte Punkt ermöglicht es den Betrieben, die Gesellen bzw. Facharbeiter später als Elektrofachkräfte im Sinne der UVV für elektronische Arbeiten im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik einzusetzen.
Innerhalb der Ausbildung gibt es eine Zwischenprüfung, bei der eine Arbeitsaufgabe bearbeitet werden muss, die zeigen soll, wie kompetent der Auszubildenden in den Bereichen Montage und Verbindungstechnik ist. Bei der Abschlussprüfung hingegen zählt mehr die Kompetenz in den Bereichen Planung, Problemlösung und Qualitätssicherung. Durch die neue Ausbildungsverordnung wurde außerdem in beiden Prüfungen ein Fachgespräch eingeführt, das begleitend zur Arbeitsaufgabe geführt wird.
Gas- und Wasserinstallateur
http://www.bs-uhk.de/berufsausbildung/teilzeit/emetall/gaswasser/index.htm
http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=2204
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=15164
www.bibb.de/redaktion/aweb/.../anlagenmech.htm
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Ausbildung-und-Beruf/ausbildungsberufe,did=76138.html
www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/id/825
www2.bibb.de/tools/fodb/pdf/eb_40587.pdf
*Meister-BAföG
Die Aufstiegsförderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), oder auch „Meister-BAföG“ genannt, existiert seit 1996. Das Ziel dieser Aufstiegsförderung ist es, die Teilnehmer bei ihrer Aufstiegsfortbildung zu unterstützen und dadurch die Rate der Existenzgründungen zu erhöhen. Für die Antragstellung sind die kommunalen Ämter für Ausbildungsförderung bei den Kreisen und den kreisfreien Städten am ständigen Wohnsitz des Antragstellers zuständig.
Gefördert werden in der Regel alle Berufsbereiche und das auch unabhängig von der Form der Fortbildung (also egal ob Voll- oder Teilzeit, schulisch oder außerschulisch, mediengestützt oder im Fernunterricht). Grundsätzliche Voraussetzung für das Meister-BAföG ist lediglich eine anerkannte und auch abgeschlossene Erstausbildung oder ein vergleichbarer Berufsabschluss. Wurde jedoch bereits eine hohe berufliche Qualifikation erreicht, wie zum Beispiel durch ein abgeschlossenes Studium, besteht keine Chance mehr auf eine Förderung.
Beachtet werden sollte, dass nicht nur angehende Meister das Meister-BAföG erhalten, sondern auch andere Teilnehmer von Kursen, die auf staatliche oder auf IHK-Abschlüsse vorbereiten. Sofern es sich um Aufstiegsfortbildungen handelt und der ausgesuchte Lehrgang ein höheres Niveau als das einer Facharbeiter-, Gesellen- oder Gehilfenprüfung, bzw. eines Berufsschulabschlusses aufweist, sind sie ebenfalls zur Förderung berechtigt.
Eine Altersbeschränkung, wie sie bei dem normalen BAföG für Studenten oder Schüler eingeführt wurde, gibt es nicht. Allerdings darf eine Vollzeitmaßnahme insgesamt nicht länger als drei Jahre und eine Teilzeitmaßnahme nicht länger als vier Jahre andauern. Des Weiteren muss eine Vollzeitmaßnahme an mindestens vier Wochentagen mit insgesamt 25 Wochenstunden stattfinden (Höchstdauer 36 Monate).
Bei einer Teilzeitmaßnahme hingegen sollten mindestens 150 Unterrichtsstunden in einem Zeitraum von acht Monaten erfolgen (Höchstdauer 48 Monate). Finanziert werden Voll- und Teilzeitmaßnahmen über einen Freibetrag, der nicht abhängig ist vom Einkommen und Vermögen der Teilnehmer, sondern der den tatsächlichen Kosten des Lehrgangs entspricht und maximal 10.226 Euro beträgt. 30,5 Prozent dieses Betrages werden als Zuschuss und 69,5 Prozent als zinsgünstiges Darlehen zur Verfügung gestellt. Während des Lehrgangs und einer Karenzzeit von zwei bis maximal sechs Jahren besteht allerdings auch bei diesem Darlehen keine Zins- und Tilgungspflicht.
Wird innerhalb der nächsten drei Jahre nach dem Abschluss der geförderten Fortbildungsmaßname einer selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit nachgegangen, kann ein Antrag auf Erlass von 66 Prozent des restlichen Darlehens, dass für die Gebühren von Prüfungen und Lehrgängen zur Verfügung gestellt wurde, beantragt werden. Voraussetzung dafür bilden jedoch die bestandene Prüfung sowie ein Nachweis darüber, dass spätestens im dritten Jahr nach der Existenzgründung mindestens zwei sozialversicherungspflichtige Beschäftigte für mindestens vier Monate angestellt wurden und zumindest einer der beiden nicht nur geringfügig beschäftigt ist.
Durch die Änderung des AFGB im Jahre 2009 werden nun unter anderem auch Zweitfortbildungen gefördert, solange bisher noch keine Förderung durch das AFGB vorgenommen wurde bzw. eine Erstfortbildung die Voraussetzung für die Zweitfortbildung ist. Und auch ausländische Fortbildungswillige wurden berücksichtigt: sofern sie bereits längerfristig aufenthaltsberechtigt sind bzw. schon lange in Deutschland leben und auch eine dauerhafte Perspektive haben um wirklich bleiben zu können, können sie nach dem AFBG gefördert werden, ohne das dies an eine vorausgegangene Mindesterwerbsdauer geknüpft ist.
http://www.meisterbafoeg.de/
http://www.meister-bafoeg.info/
http://www.bafoeg-aktuell.de/cms/karriere/meister-bafoeg/
http://www.daa-technikum.de/aktuelles/index-bafoeg.php3
http://www.daa-technikum.de/aktuelles/index-bafoeg.php3
http://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/
|
|
VEDAT HORUZ
ist 30 Jahre alt, wurde in Göppingen geboren und hat sechs Geschwister. Nach der Grundschule hat er die Hauptschule abgeschlossen und anschließend eine Ausbildung zum Gas- und Wasser-Installateur begonnen. Da er jedoch häufig zu spät kam flog er nach einem Jahr von der Schule. Anschließend hat er eine Ausbildung zum Maler absolviert und dann eineinhalb Jahre auf dem Bau gearbeitet. Da ihm der Beruf als Maler nicht gefallen hat, hat er wieder gekündigt und war daraufhin über zwei Jahre arbeitslos. Im Alter zwischen 19 und 20 Jahren hat er sich entschieden, in einer Abendschule die Mittlere Reife nachzuholen und anschließend das Berufskolleg 1 und 2 zu besuchen, um die Fachhochschulreife zu erlangen. Anschließend hat er an der Fachhochschule Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ist nun seit einem Jahr berufstätig.
Gas- und Wasser-Installateur/ siehe bei Serafettin Deger
Maler und Lackierer
Vedat Horuz hat eine Ausbildung zum Maler absolviert. Maler und Lackierer gestalten Oberflächen und sind viel im Freien tätig. Dort arbeiten sie entweder in Neubauten, oder in der Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung und Denkmalpflege auf den verschiedensten Baustellen. Diese befinden sich zum Beispiel im privaten und öffentlichen Bereich, im Wohnungs-, Gewerbe-, Industrie- sowie Anlagenbau.
Maler und Lackierer ist nach der Handwerksordnung ein anerkannter Ausbildungsberuf, der sowohl im dualen System als auch rein schulisch erlernt werden kann. Voraussetzung für eine Ausbildung ist mindestens ein Hauptschulabschluss. Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre und wird in den folgenden drei verschiedenen Fachrichtungen angeboten: Gestaltung und Instandhaltung, Bauten- und Korrosionsschutz sowie Kirchenmalerei und Denkmalpflege. Die Ausbildung kann jedoch auch in zwei Stufen erfolgen, wobei innerhalb der ersten zwei Jahre der Titel Bauten- und Objektbeschichter und erst in der zweiten Stufe (innerhalb eines weiteren Jahres) der Titel Maler und Lackierer Bauten- und Korrosionsschutz oder Gestaltung und Instandhaltung erworben wird. Zu den allgemeinen Kernkompetenzen, die während der Ausbildung erworben werden, gehören: Anstreichen, Außenanstrich und Fassadenanstrich, Fassadeninstandhaltung und Fassadensanierung, Innenanstrich, Lackieren, Tapezieren sowie Untergrundbehandeln.
Ist ein Maler und Lackierer im Besitz von mehreren Jahren Berufserfahrung, kann er sich zum Maler- und Lackierermeister, zum Techniker im Bereich Farb- und Lasertechnik oder zum Gestalter weiterbilden lassen. Zusätzlich besteht für Personen mit einer Hochschulzugangberechtigung auch noch die Möglichkeit, ein Studium als Diplom-Ingenieur für Farben, Lacke und Kunststoffe, für Werkstofftechnik, für Chemie oder für Architektur aufzunehmen.
http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_14186.htm
http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=15175
http://www.bildung-news.com/?s=Maler+und+Lackierer
Wirtschaftsingenieurwesen siehe bei Gökce Kök
|
|
MURAT GÜL
ist 1971 in Sivas/Türkei geboren. Mit 10 Jahren kam er mit seinen Eltern in die Rheinland Pfalz nach Wörth. Nach dem er die Hauptschule als Klassenbester abgeschlossen hat, hat er eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker gemacht. Nach zwei Jahren Berufserfahrung als Automechaniker, hat er bemerkt, dass es kaum türkischstämmige Meister in diesem Beruf gibt. Somit entschloss er sich seinen Meister zu machen. Bald darauf hat sich Murat Gül selbstständig gemacht und besitzt heute eine eigene Autowerkstatt in Schwaikheim. Er möchte, dass sich seine Auszubildenden als gute Fachkräfte auf dem Berufsmarkt auszeichnen.
Kfz - Mechaniker = heute: Kfz - Mechatroniker
Murat Gül hat nach der Hauptschule eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht. Die Ausbildung und Berufsbezeichnung Kfz-Mechaniker sind seit 2003 von der Ausbildung und Berufsbezeichnung Kfz-Mechatroniker abgelöst worden. Grund hierfür sind die veränderten Bedingungen im Kraftfahrzeugbau. Die neue Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker für entweder Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik oder Fahrzeugkommunikationstechnik geht auf diese veränderten Bedingungen ein. Mittlerweile steht die Verbindung von mechanischen und elektrischen sowie elektronischen Bestandteilen in Kraftfahrzeugen, die sich von Jahr zu Jahr verstärkt, stärker im Mittelpunkt der Ausbildung als zuvor. Trotzdem sind Kfz-Mechaniker wie -Mechatroniker immer noch hauptsächlich mit der Herstellung und Sicherung der Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit von PKW und anderen Kraftfahrzeugen beschäftigt, vor allem in Kfz-Werkstätten, wo sie überwiegend Reparaturarbeiten ausführen.
Voraussetzung für die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ist ein mindestens guter Realschulabschluss oder ein sehr guter Hauptschulabschluss. Die mittlerweile überaus komplexe Technik von Kraftfahrzeugen erfordert außerdem ein sehr gutes Verständnis von vernetzten Systemen. Auch das Interesse für Kraftfahrzeuge und ein gutes physikalisch-technisches Verständnis, vor allem für die Bereiche Elektronik, Pneumatik und Hydraulik, sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.
Die Ausbildung kann in jedem Betrieb des Kfz-Gewerbes absolviert werden, der bereits zuvor zur Ausbildung von Kfz-Mechanikern bzw. Kfz-Elektrikern zugelassen war. Das heißt in Auto- oder Kfz-Werkstätten und Reparaturbetrieben oder im Pannenhilfsdienst, aber auch bei Kraftfahrzeugherstellern oder in Autohäusern und im Ersatzteilhandel.
Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und findet im jeweiligen Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule statt. Vor Beginn der Ausbildung wird im Ausbildungsvertrag ein Ausbildungsschwerpunkt festgelegt, entweder Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik oder Fahrzeugkommunikationstechnik. Die ersten beiden Jahre der Ausbildung erfolgen für alle Richtungen gemeinsam, erst die letzten eineinhalb Jahre sind allein dem jeweiligen Schwerpunkt gewidmet. Weitere Inhalte der Ausbildung sind für den jeweiligen Schwerpunktbereich Montieren und Demontieren, Nachrüsten, Umbauen, Prüfen, Messen und Diagnostizieren. Die Ausbildung schließt mit einer Gesellenprüfung ab. Nach der Gesellenprüfung besteht die Möglichkeit die Meisterschule zu besuchen, eine unerlässliche Voraussetzung um später selbstständig tätig zu werden oder als Berufsschullehrer zu arbeiten. Kfz-Mechaniker bzw. Mechatroniker sind hauptsächlich in Kfz-Werkstätten in der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen tätig. Sie können auch bei Kraftfahrzeugherstellern sowie im Kraftfahrzeug- oder Ersatzteilhandel Beschäftigung finden. Arbeitsplätze sind in erster Linie Fertigungs- und Werkhallen sowie Werkstätten und Lager. Zusätzlich zur eigentlichen Reparaturarbeit gehört auch die Beratung und Betreuung der Kunden und damit auch der Umgang mit Computern zu den Aufgaben von Kfz-Mechatronikern.
http://www.autoberufe.de/ausbildung/ausbildungsberufe/index_20060601155003.html
http://www.ulmato.de/kfz_mechaniker.asp
http://autotipps.net/kfz-lexikon/kfz-mechaniker-mechatroniker-ausbildung
http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_14262.htm
Meister/in im Kfz-Techniker-Handwerk
Murat Gül hat nach zweijähriger Berufserfahrung seinen Meister gemacht.
Ein Kfz-Betrieb und damit auch der Meister / die Meisterin im Kfz-Techniker-Handwerk kann eine breite Palette von Wartungs-, Reparatur-, Diagnose- und Karosseriearbeiten bis hin zur Fahrzeuglackierung anbieten. Die Einsatzmöglichkeiten eines Meisters/einer Meisterin gehen somit über den Rahmen eines einzelnen Ausbildungsberufes hinaus.
Meister/innen können verschiedene Leitungsfunktionen, z.B. eines gesamten Autohauses, des Kundendienstes oder der Werkstatt, übernehmen. Sie erstellen Aufträge nach den Kriterien Termineinhaltung, Vollständigkeit, Arbeitsqualität und Zeiterfassung sicher und koordinieren die Werkstattmitarbeiter bei übergreifenden Arbeitsaufträgen. Darüber hinaus kalkulieren sie Reparaturen, erstellen Kostenvoranschläge und unterstützen Gesellen in schwierigen Reparaturfällen. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören ebenso die Endkontrolle der Werkstattarbeit, der Ausbildungsergebnisse der Lehrlinge sowie die Organisation von innerbetrieblichen Schulungen.
Seit 2001 gibt es die neue Meisterprüfung im Kfz-Techniker-Handwerk mit einer Differenzierung für den praktischen Teil (Teil I) in die Handlungsfelder "Fahrzeugsystemtechnik" oder "Fahrzeugkarosserietechnik". Wer Kfz-Servicetechniker ist, braucht Teil I der Meisterprüfung nicht mehr abzulegen. Die Meisterprüfung ist Voraussetzung für eine Führungsposition bzw. den Schritt in die Selbstständigkeit.
Die Voraussetzungen:
Um die Weiterbildung zum Meister/ zur Meisterin im Kfz-Techniker-Handwerk absolvieren zu können, benötigt man folgende Vorbildung:
• Eine abgeschlossene Gesellenprüfung im Kfz-Handwerk oder
• Eine abgeschlossene Gesellenprüfung in einem anderen Handwerk und der Nachweis über 3 Jahre Berufstätigkeit im Kfz-Handwerk
Die Weiterbildungsdauer:
1.600 Stunden; bei Vollzeitunterricht ca. 1 Jahr für alle 4 Teile der Meisterprüfung
Teil I: Fachpraxis
Teil II: Fachtheorie
Teil III: Unternehmensführung
Teil IV: Arbeitspädagogik
Nützliche Hinweise zur Meisterfortbildung:
http://www.zwh.de
Detaillierte Informationen zum Meister-BAföG:
http://www.meister-bafoeg.info
http://www.btz-heide.de/index.htm?/kfz_meister.htm
http://www.kfz-komzet.de/seminare/weiterbildung/kfz-techniker-meister-vorbereitung.html
http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_14262.htm
|
|
|
 |
Ilyas Kablan
Softwareberater
Telekomunikation
link
|
|

|
Gökce Kök
Wirtschaftsingenieurin
Projektkoordination
link
|
|

|
Ali Ayhan
Sortimentsmanager
After-Sales Technik
link
|
 |
Yasemin Arpacı
Teamleiterin
Service Contracts
link
|
|

|
Gül Ünsal
Mechatronikerin
Produktion
link
|
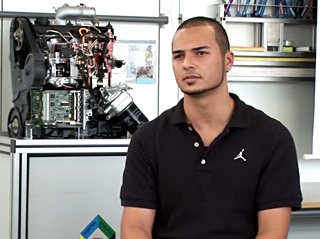 |
Hakan Karıncalı
Mechatroniker
Produktion
link
|
 |
Doğan Eşiyok
Fachinformatiker
Entwicklung
link
|
 |
Aliye Duran
Ausbilderin
Textilunternehmen
link
|
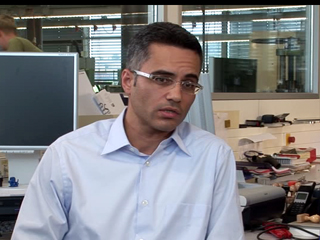 |
Fatih Kasımoğlu
Mechatroniker
Entwicklung
link
|
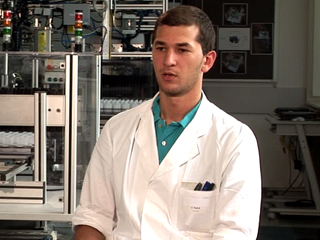 |
Uğur Öztürk
Elektroniker
Industrie
link
|
 |
Sultan Kuruova
Hotelfachfrau
Gastronomie
link
|
 |
Serkan Aydın
Bäcker
Ernährung
link
|
 |
Şerafettin Değer
Installations-und Heizungsbauer
Handwerk
link
|
 |
Vedat Horuz
Wirtschaftsingenieur
Industrie
link
|
 |
Murat Gül
KFZ-Mechaniker/Meister
Handwerk
link
|
|





