BILDUNGSNAVIGATOR
Baden-Württemberg verfügt über vielfältige und attraktive Angebote im Bereich Aus- und Weiterbildung. Vor allem den im Land lebenden türkischstämmigen Bürgerinnen und Bürgern ist jedoch nicht ausreichend bekannt, welche Möglichkeiten dies sind. Es ist auch nicht immer ganz leicht, die passenden Wege in Ausbildung und Beruf zu finden sowie vorhandene staatliche Förderungen zu verstehen und zu nutzen. Wir wollen daher mit dem Bildungsnavigator dazu beitragen, dass Sie einen besseren Überblick über die Bildungsmöglichkeiten insbesondere in Baden-Württemberg erhalten, um diese Angebote besser nutzen zu können. Dieser Überblick soll Ihnen so beispielsweise den Weg von den unterschiedlichen Schulabschlüssen zur Berufsausbildung, Weiterbildung und Studium aufzeigen.
|
|
Werkrealschule
Die Werkrealschulen in Baden-Württemberg gelten als Weiterentwicklung der Hauptschule, die nach einer Dauer von sechs Jahren zu dem Abschluss der Mittleren Reife führen. Zu Beginn der 8. Klasse wählen die Schüler eines von drei Wahlpflichtfächern (Wirtschaft und Informationstechnik, Gesundheit und Soziales, Natur und Technik), dass dann in den kommenden zwei Schuljahren (also in der 8. und 9. Klasse) besucht wird. Diese berufsbezogenen Fächer sind inhaltlich bereits auf die zweijährige Berufsfachschule abgestimmt. Nach diesen zwei Schuljahren wird bei einer Klassenkonferenz von allen Lehrern, die den Schüler unterrichtet haben, eine Bildungsempfehlung ausgesprochen. Liegt der Notendurchschnitt in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und in dem Wahlpflichtfach bei 3,0 oder besser (schlechter als ausreichend darf die Note jedoch in keinem Fach sein), erfolgt die Empfehlung für die 10. Klasse. Sollten die Noten nicht erbracht werden, kann - in Ausnahmefällen - die Versetzung in die 10. Klasse trotzdem beschlossen werden. Ab der 10. Klasse besuchen die Schüler dann an drei Tagen in der Woche die Werkrealschule und an den anderen zwei Tagen das erste Jahr der zweijährigen Berufsfachschule. Die Angebote unterscheiden sich von Ort zu Ort, beinhalten aber immer drei verschiedene Bereiche mit insgesamt zehn Profilen:
a) Kaufmännischer Bereich: Wirtschaft und Verwaltung
b) Gewerblich-Technischer Bereich: Metalltechnik, Elektrotechnik, Labortechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung, Fahrzeugtechnik
c) Bereich Ernährung und Gesundheit: Gesundheit und Pflege, Hauswirtschaft und Ernährung, Ernährung und Gastronomie Die Abschlussprüfung findet letztlich sowohl in der Werkrealschule als auch in der Berufsfachschule statt. Die Idee hinter der Werkrealschule ist, dass die Absolventen nach dem Abschluss der Werkrealschule bereits eine berufliche Grundbildung besitzen und dadurch auch bessere Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben.
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/xmsm8do747bzsc49pd1o2d5kg1pjjsfz/menu/1188445/
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/oy5me689ary81vcuppfpqg08vq9bi71
www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/show/1262669/
|
|
Berufskolleg
Da in den einzelnen Bundesländern zum Teil unterschiedliche Bildungssysteme vorherrschen, werden mit dem Namen Berufskolleg teilweise ganz unterschiedliche Schulsysteme und Bildungsgänge bezeichnet. Das Angebot an den verschiedenen Berufskollegs ist insgesamt sehr vielfältig:
a) Technisches Berufskolleg I und II: Medientechnischer Bereich
b) Kaufmännisches Berufskolleg I und II, Berufskolleg Fremdsprachen: Bereich Wirtschaft und Verwaltung
c) Berufskolleg für Ernährung und Hauswirtschaft I und II: Hauswirtschaftlicher Bereich
d) Berufskolleg Gesundheit und Pflege I und II: Pflegerischer Bereich In Baden-Württemberg zählt das Berufskolleg zur Erlangung der Fachhochschulreife (BKFH) als einjährige Berufsoberschule, also zu den Vollzeitschulen des zweiten Bildungsweges.
Innerhalb eines Jahres werden die Schüler mit Vollzeitunterricht zur Fachhochschulreife geführt und können dadurch an allen Fachhochschulen im Bundesgebiet studieren. Vorraussetzung für den Besuch ist die mittlere Reife und zusätzlich noch eine abgeschlossene Berufsausbildung. Dieser Abschluss der Berufsausbildung bestimmt dann auch den Schwerpunkt des Unterrichts (kaufmännisch, technisch etc.). Zusätzlich gibt es in Baden-Württemberg auch Berufskollegs, bei denen – nach der mittleren Reife – innerhalb von zwei Jahren eine Ausbildung zum staatlich geprüften Assistenten (zum Beispiel staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent) absolviert werden kann. Durch Zusatzunterricht in Mathematik und Naturwissenschaften kann dann ebenfalls zeitgleich mit dem Assistentenabschluss die Fachhochschulreife erworben werden. In einigen Bundesländern besteht außerdem unter anderem die Möglichkeit, mithilfe des Berufskollegs, zum Beispiel in den Bildungsgängen der Gymnasialen Oberstufe (GOS), gleichzeitig das Abitur und eine berufliche Qualifikation zu erwerben. Nach dem Muster der gymnasialen Oberstufe ist der Unterricht in Grund- und Leistungskurse unterteilt, wobei das Fächerangebot des Gymnasiums durch berufsbezogene Fächer erweitert wird. So kommen zum Beispiel im kaufmännischen Bereich die Fächer Wirtschaftsinformatik oder VWL hinzu. In der 12. Jahrgangsstufe muss außerdem ein Betriebspraktikum, mit einer Mindestdauer von vier Wochen, in dem gewählten beruflichen Bereich absolviert werden. Am Ende der 13. Jahrgangsstufe werden das Abitur und der erste Teil der Berufsabschlussprüfung absolviert. Anschließend müssen alle Absolventen (außer den Erziehern) ein Betriebspraktikum über 12 Wochen absolvieren, das von der Schule begleitet wird. Erst danach erfolgt dann der zweite Teil der Berufsabschlussprüfung. Alles in allem tragen die Berufskollegs zur Durchlässigkeit des Bildungssystems bei und bieten eine allgemeinbildende und auch berufsbezogene Alternative zur Sekundarstufe II an Gymnasien oder Gesamtschulen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berufskolleg
http://www.ib-bildung.de/gf/berufskollegs/
http://www.schule-bw.de/schularten/berufliche_schulen/vollzeitschulen/berufskollegs/
|
|
Technisches Gymnasium
Das technische Gymnasium, das auch unter dem Namen Fachgymnasium technischer Zweig bekannt ist, gehört zu den Vollzeitschulen und ist eine spezielle Form des Gymnasiums. Im Vergleich zu einem allgemeinen Gymnasium ist das technische Gymnasium eher anwendungsorientiert, was sich vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik, Chemie, Technik und Mathematik auswirkt, die intensiver als auf allgemeinen Gymnasien behandelt werden. Zu den momentan angebotenen Profilen gehören: Technik, Gestaltungs- und Medientechnik, Informationstechnik, Technik und Management (in einem Schulversuch), Angewandte Naturwissenschaften (an einem Standort) und Technik mit Schwerpunkt Elektro- und Informationstechnik (ebenfalls nur an einem Standort). In Baden Württemberg besteht der Bereich Technik aus den Unterfächern Maschinenbau, Werkstoffkunde, Statik (Physik) sowie Elektro- und Digitaltechnik. Die Unterfächer der Gestaltungs- und Medientechnik sind Gestaltungs- und Medientechnik, Computertechnik (Bildbearbeitung/CAD) und angewandte Gestaltungstechnik. Zu den Unterfächern der Informationstechnik gehören Informationstechnik (Digitaltechnik), angewandte Informationstechnik ebenso wie Software. Und im Bereich Technik und Management zählen schließlich Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften und Projektmanagement zu den Unterfächern.
http://www.schule-bw.de/schularten/berufliche_schulen/vollzeitschulen/berufliche_gymnasien/tg/
http://de.wikipedia.org/wiki/Technisches_Gymnasium
|
|
Voraussetzungen für die Verkürzung der Ausbildungszeit
Es gibt verschiedene Gründe um einen Antrag auf die Verkürzung der regulären Ausbildungszeit zu stellen. Die rechtliche Grundlage für eine Verkürzung bilden dabei das Berufsbildungsgesetz und eine Empfehlung des Bundesinstituts für Berufsbildung zur Verkürzung und Verlängerung der Berufsausbildung vom 26.06.2008. Allerdings sind die Regelungen zur Ausbildungsverkürzung in den einzelnen Bundesländern verschieden, weshalb es sinnvoll ist, sich zusätzlich bei der zuständigen Kammer (z.B. IHK oder Handwerkskammer) zu informieren, bei der auch der Antrag gestellt werden soll. Folgende verschiedenen Möglichkeiten zur Verkürzung stehen zur Verfügung:
1) Anrechnung der beruflichen Vorbildung (§ 7 Berufsbildungsgesetz) Wurde eine Berufsausbildung in einer anderen Einrichtung (zum Beispiel einer Fachschule), ein Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) oder aber ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) absolviert, kann dies teilweise oder sogar ganz auf die jetzige Ausbildung angerechnet werden.
2)Verkürzung durch den allgemeinen Schulabschluss (§ 8 Berufsbildungsgesetz) Sobald der Auszubildende einen höheren allgemeinen Schulabschluss als den Hauptschulabschluss hat, kann vom Auszubildenden und Ausbilder gemeinsam eine Ausbildungsverkürzung beantragt werden. Ist der Auszubildende im Besitz der Fachoberschulreife (also zum Beispiel eines Realschulabschlusses) ist eine Kürzung um sechs Monate möglich, wohingegen die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife dazu beitragen können, dass die Ausbildungszeit um volle zwölf Monate verkürzt werden kann.
3) Verkürzung wegen beruflicher Vorbildung (§ 8 Berufsbildungsgesetz) Eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung kann eine Kürzung um zwölf Monate bewirken und Berufserfahrung, Arbeitserfahrung oder eine berufliche Grundbildung können ebenfalls angemessen berücksichtigt werden. Zu Beachten ist hierbei, dass eine solche Verkürzung am Anfang der Berufsausbildung, oder spätestens ein Jahr vor dem Ausbildungsende bei der zuständigen Stelle beantragt werden sollte.
4) Verkürzung bei einem Ausbildungsplatzwechsel Wurde bereits in demselben Beruf eine Ausbildung begonnen, so kann die Ausbildungszeit teilweise oder ganz anerkannt werden. Bei einem Wechsel von einem ähnlichen Beruf nach der Grundausbildung hingegen ist eine Kürzung um zwölf Monate möglich. Selbstverständlich muss in diesem Fall der neue Betrieb mit dem Wechsel sowie der Tatsache, dass bereits Ausbildungszeit zurückgelegt wurde, einverstanden sein.
5) Teilzeitberufsausbildung (§ 8 Berufsausbildungsgesetz) Liegt ein berechtigter Grund vor (z.B. ein Kind oder ein pflegebedürftiger Angehöriger), besteht die Möglichkeit statt der Kürzung der Ausbildung insgesamt einen Antrag auf Verkürzung der täglichen Ausbildungszeit zu stellen und somit eine Teilzeitberufsausbildung zu absolvieren. In diesem Fall kann die wöchentliche Ausbildungszeit auf 25 Stunden reduziert werden und dies ohne dass die kalendarische Ausbildungszeit verlängert wird. Allerdings ist das nur möglich, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel auch wirklich in der kürzeren Zeit erreicht werden kann. Problematisch ist jedoch, dass bisher nur wenige Betriebe solch eine Teilzeit-Berufsausbildung anbieten.
6) Verkürzung wegen guter Leistungen (§ 45 Berufsbildungsgesetz) Auch bei der Erbringung guter Leistungen in der Schule und dem Betrieb kann eine Verkürzung beantragt werden. So kann der Auszubildende vorzeitig zur Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn sein Notendurchschnitt in allen prüfungsrelevanten Fächern und die betriebliche Leistungsbewertung besser als 2,49 ist. Wurde die Verkürzung genehmigt, besteht für den Auszubildenden dann die Chance seine Prüfung bis zu sechs Monate vor dem eigentlichen Prüfungstermin abzulegen. Insgesamt können Auszubildende zwar aus mehreren Gründen ihre Ausbildungszeit verkürzen, folgende Mindestzeiten sollten dabei aber nicht unterschritten werden: Bei einer normalen Ausbildungszeit von dreieinhalb Jahren sollte die verkürzte Ausbildungszeit nicht weniger als 24 Monate, bei einer Ausbildungszeit von drei Jahren nicht weniger als 18 Monate und bei einer Ausbildungszeit von zwei Jahren nicht weniger als 12 Monate andauern.
http://www.azubi-azubine.de/mein-recht-als-azubi/verkuerzung-verlaengerung-der-ausbildung.htmll
http://www.ausbildung.net/ausbildungsverlauf/verkuerzung-der-ausbildung.html
|
|
Meister-BAföG
Die Aufstiegsförderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), oder auch „Meister-BAföG“ genannt, existiert seit 1996. Das Ziel dieser Aufstiegsförderung ist es, die Teilnehmer bei ihrer Aufstiegsfortbildung zu unterstützen und dadurch die Rate der Existenzgründungen zu erhöhen. Für die Antragstellung sind die kommunalen Ämter für Ausbildungsförderung bei den Kreisen und den kreisfreien Städten am ständigen Wohnsitz des Antragstellers zuständig. Gefördert werden in der Regel alle Berufsbereiche und das auch unabhängig von der Form der Fortbildung (also egal ob Voll- oder Teilzeit, schulisch oder außerschulisch, mediengestützt oder im Fernunterricht). Grundsätzliche Voraussetzung für das Meister-BAföG ist lediglich eine anerkannte und auch abgeschlossene Erstausbildung oder ein vergleichbarer Berufsabschluss. Wurde jedoch bereits eine hohe berufliche Qualifikation erreicht, wie zum Beispiel durch ein abgeschlossenes Studium, besteht keine Chance mehr auf eine Förderung. Beachtet werden sollte, dass nicht nur angehende Meister das Meister-BAföG erhalten, sondern auch andere Teilnehmer von Kursen, die auf staatliche oder auf IHK-Abschlüsse vorbereiten. Sofern es sich um Aufstiegsfortbildungen handelt und der ausgesuchte Lehrgang ein höheres Niveau als das einer Facharbeiter-, Gesellen- oder Gehilfenprüfung, bzw. eines Berufsschulabschlusses aufweist, sind sie ebenfalls zur Förderung berechtigt. Eine Altersbeschränkung, wie sie bei dem normalen BAföG für Studenten oder Schüler eingeführt wurde, gibt es nicht. Allerdings darf eine Vollzeitmaßnahme insgesamt nicht länger als drei Jahre und eine Teilzeitmaßnahme nicht länger als vier Jahre andauern. Des Weiteren muss eine Vollzeitmaßnahme an mindestens vier Wochentagen mit insgesamt 25 Wochenstunden stattfinden (Höchstdauer 36 Monate). Bei einer Teilzeitmaßnahme hingegen sollten mindestens 150 Unterrichtsstunden in einem Zeitraum von acht Monaten erfolgen (Höchstdauer 48 Monate). Finanziert werden Voll- und Teilzeitmaßnahmen über einen Freibetrag, der nicht abhängig ist vom Einkommen und Vermögen der Teilnehmer, sondern der den tatsächlichen Kosten des Lehrgangs entspricht und maximal 10.226 Euro beträgt. 30,5 Prozent dieses Betrages werden als Zuschuss und 69,5 Prozent als zinsgünstiges Darlehen zur Verfügung gestellt. Während des Lehrgangs und einer Karenzzeit von zwei bis maximal sechs Jahren besteht allerdings auch bei diesem Darlehen keine Zins- und Tilgungspflicht. Wird innerhalb der nächsten drei Jahre nach dem Abschluss der geförderten Fortbildungsmaßname einer selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit nachgegangen, kann ein Antrag auf Erlass von 66 Prozent des restlichen Darlehens, dass für die Gebühren von Prüfungen und Lehrgängen zur Verfügung gestellt wurde, beantragt werden. Voraussetzung dafür bilden jedoch die bestandene Prüfung sowie ein Nachweis darüber, dass spätestens im dritten Jahr nach der Existenzgründung mindestens zwei sozialversicherungspflichtige Beschäftigte für mindestens vier Monate angestellt wurden und zumindest einer der beiden nicht nur geringfügig beschäftigt ist. Durch die Änderung des AFGB im Jahre 2009 werden nun unter anderem auch Zweitfortbildungen gefördert, solange bisher noch keine Förderung durch das AFGB vorgenommen wurde bzw. eine Erstfortbildung die Voraussetzung für die Zweitfortbildung ist. Und auch ausländische Fortbildungswillige wurden berücksichtigt: sofern sie bereits längerfristig aufenthaltsberechtigt sind bzw. schon lange in Deutschland leben und auch eine dauerhafte Perspektive haben um wirklich bleiben zu können, können sie nach dem AFBG gefördert werden, ohne das dies an eine vorausgegangene Mindesterwerbsdauer geknüpft ist.
http://www.meisterbafoeg.de/
http://www.meister-bafoeg.info/
http://www.bafoeg-aktuell.de/cms/karriere/meister-bafoeg/
http://www.daa-technikum.de/aktuelles/index-bafoeg.php3
http://www.bmbf.de/de/851.php
http://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/
|
|
Weiterbildung zum Handelsassistenten/zur Handelsassistentin
Handelsassistent/in im Einzelhandel ist eine bundesweit einheitlich geregelte berufliche Aus- bzw. Weiterbildung, die zu den Aufstiegsfortbildungen gehört. Durchgeführt werden die Lehrgänge mit jeweils unterschiedlicher Dauer von Industrie- und Handelskammern (IHK), Bildungszentren des Einzelhandels oder anderen Bildungsstätten privater Bildungsträger. Seit dem Jahre 2007 wird der Schwerpunkt der Fortbildung zum Handelsassistenten (IHK) auf die Bereiche Führung und Marketing am Point of Sale gelegt, um die Handelsassistenten besser auf die Wahrnehmung der Aufgaben eines Abteilungsverantwortlichen bzw. Markt- oder Filialleiters vorzubereiten. Handelsassistenten und –assistentinnen arbeiten überwiegend in Einzelhandelsunternehmen von verschiedenen Wirtschaftszweigen, zum Beispiel in Textil- und Bekleidungsgeschäften, in Supermärkten oder in Möbelhäusern, in denen sie dann mittlere und unter Umständen auch höhere Leitungsfunktionen übernehmen können. Ein „Geprüfter Handelsassistent -Einzelhandel“ erhält somit, durch die erfolgreiche Absolvierung des Bildungsganges, die Möglichkeit als Führungskraft der mittleren Ebene zu arbeiten, also als Substitut, Abteilungs- oder Marktleiter. Die Weiterbildung zum Handelsassistenten kann entweder berufsbegleitend als Teilzeitlehrgang, oder aber als Vollzeitweiterbildung erfolgen. Im Schnitt dauert er 390 bis 420 Stunden. Abiturientinnen und Abiturienten haben außerdem noch die Möglichkeit, die Weiterbildung zum Einzelhandelsassistenten mit der dualen Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau im Einzelhandel zu kombinieren. Geprüft werden darf am Ende jeder, der entweder eine Abschlussprüfung in einem anerkannten kaufmännischen Ausbildungsberuf (mit einer Ausbildungsdauer von drei Jahren) mit Erfolg abgelegt hat und über eine mindestens einjährige Berufspraxis verfügt. Oder wer eine Ausbildung als Verkäufer mit einer Dauer von zwei Jahren absolviert hat und zusätzlich mindestens zwei Jahre Berufspraxis in verkäuferischen oder anderen kaufmännischen Tätigkeiten im Einzelhandel nachweisen kann. Neben diesen beiden Möglichkeiten wird auch eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren anerkannt, wobei zusätzlich auch die Ausbildungszeit in einem anderen kaufmännischen Ausbildungsberuf angerechnet werden kann. Eine Zulassung zur Prüfung lässt sich auch dann rechtfertigen, wenn der Bewerber seine Kenntnisse und Fertigkeiten glaubhaft belegen (durch Zeugnisse etc.). Die Prüfung selbst besteht sowohl aus einem schriftlichen als auch einem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung beinhaltet folgende Handlungsbereiche: Vertriebsmanagement; Kundenorientierung; Marketing im Einzelhandel; Visuelles Marketing (Visual Merchandising); Führung, Kommunikation, Selbstmanagement; Personalmanagement sowie Volkswirtschaft für die Einzelhandelspraxis. Die mündliche Prüfung hingegen setzt sich aus einer Präsentation und einem Fachgespräch zusammen. Die Themenstellung der Präsentation bezieht sich auf mindestens zwei der oben genannten Handlungsbereiche und das Fachgespräch - ausgehend davon - auf Situationen die typisch für den Vertrieb sind. Mit der Prüfung soll insgesamt festgestellt werden, ob die Handelsassistenten die erforderlichen Erfahrungen und Qualifikationen haben, um in unterschiedlichen Betriebsformen sowohl Fach-, Organisations- und auch Führungsaufgaben im Vertrieb zu übernehmen und des Weiteren, ob sie auch fähig zum Einsatz betriebswirtschaftlicher und personalwirtschaftlicher Managementinstrumente sind.
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=6533
http://www.zbb.de/bildung/weiterbildung/aufstiegsweiterbildung/handelsassistent.html
http://www.einzelhandel.de/pb/site/hde/node/29105/Lde/index.html
http://www.einzelhandel.de/pb/site/hde/node/29125/Lde/index.html
|
|
* Technisches Gymnasium:
Das technische Gymnasium, das auch unter dem Namen Fachgymnasium technischer Zweig bekannt ist, gehört zu den Vollzeitschulen und ist eine spezielle Form des Gymnasiums. Im Vergleich zu einem allgemeinen Gymnasium ist das technische Gymnasium eher anwendungsorientiert, was sich vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik, Chemie, Technik und Mathematik auswirkt, die intensiver als auf allgemeinen Gymnasien behandelt werden. Zu den momentan angebotenen Profilen gehören: Technik, Gestaltungs- und Medientechnik, Informationstechnik, Technik und Management (in einem Schulversuch), Angewandte Naturwissenschaften (an einem Standort) und Technik mit Schwerpunkt Elektro- und Informationstechnik (ebenfalls nur an einem Standort). In Baden Württemberg besteht der Bereich Technik aus den Unterfächern Maschinenbau, Werkstoffkunde, Statik (Physik) sowie Elektro- und Digitaltechnik. Die Unterfächer der Gestaltungs- und Medientechnik sind Gestaltungs- und Medientechnik, Computertechnik (Bildbearbeitung/CAD) und angewandte Gestaltungstechnik. Zu den Unterfächern der Informationstechnik gehören Informationstechnik (Digitaltechnik), angewandte Informationstechnik ebenso wie Software. Und im Bereich Technik und Management zählen schließlich Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften und Projektmanagement zu den Unterfächern
http://www.schule-bw.de/schularten/berufliche_schulen/vollzeitschulen/berufliche_gymnasien/tg/ Technisches Gymnasium
http://de.wikipedia.org/wiki/Technisches_Gymnasium
|
|
|
 |
Ilyas Kablan
Softwareberater
Telekomunikation
link
|
|

|
Gökce Kök
Wirtschaftsingenieurin
Projektkoordination
link
|
|

|
Ali Ayhan
Sortimentsmanager
After-Sales Technik
link
|
 |
Yasemin Arpacı
Teamleiterin
Service Contracts
link
|
|

|
Gül Ünsal
Mechatronikerin
Produktion
link
|
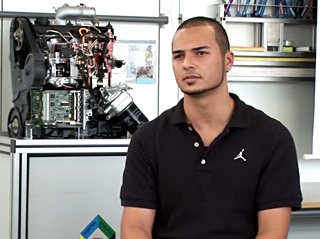 |
Hakan Karıncalı
Mechatroniker
Produktion
link
|
 |
Doğan Eşiyok
Fachinformatiker
Entwicklung
link
|
 |
Aliye Duran
Ausbilderin
Textilunternehmen
link
|
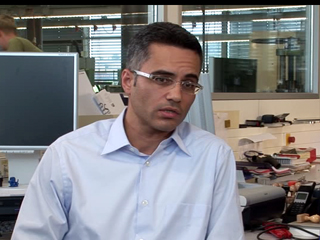 |
Fatih Kasımoğlu
Mechatroniker
Entwicklung
link
|
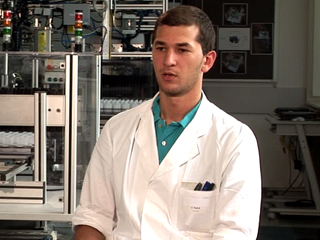 |
Uğur Öztürk
Elektroniker
Industrie
link
|
 |
Sultan Kuruova
Hotelfachfrau
Gastronomie
link
|
 |
Serkan Aydın
Bäcker
Ernährung
link
|
 |
Şerafettin Değer
Installations-und Heizungsbauer
Handwerk
link
|
 |
Vedat Horuz
Wirtschaftsingenieur
Industrie
link
|
 |
Murat Gül
KFZ-Mechaniker/Meister
Handwerk
link
|
|





